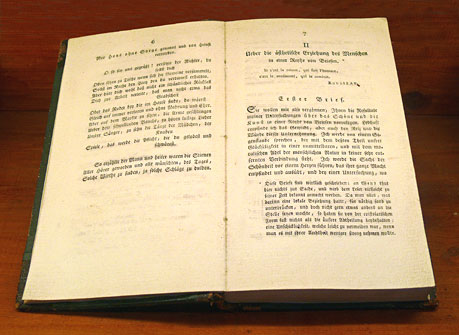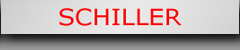EINNORDEND EINORDNENDES VORBLATT ZU:
Die Bedeutung des Spielbegriffs in Schillers Briefen »Über die ästhetische Erziehung des Menschen«
Bei den folgenden Seiten zur Bedeutung des Spielbegriffs in Schillers Briefen »Über die ästhetische Erziehung des Menschen« handelt es sich – wie unschwer zu erkennen ist – um meine Examensarbeit bzw. Erste Staatsarbeit von 1977 (damals allerdings noch als »Hausarbeit« bezeichnet) bei Prof. Dr. Wilhelm Voßkamp an der Universität Bielefeld (in der Stadt, die mit dem verballhornenden Slogan »freundliche Baustelle am Teutoburger Wald« bis auf den heutigen Tag leben muss) im Fach Germanistik der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft (kurz auch LiLi-Fak! genannt).
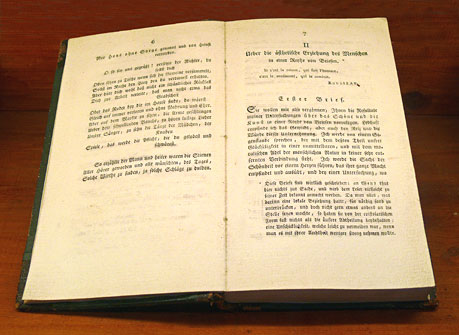
Sowohl These, Begründung, Ergebnis als auch Vorgehensweise und inhaltliche Gesamtaussage zur Bedeutung des Schillerschen Spielbegriffs finden auch gegenwärtig insgesamt meine uneingeschränkte Zustimmung und bedürfen nach meiner Einschätzung keine grundlegende Überarbeitung (lediglich Orthographie und Interpunktion haben in der hier vorliegenden Fassung eine an der sog. »Rechtschreibreform« orientierte Angleichung erfahren).
Zur Zeit der Abfassung meiner Arbeit stellte sich die Materiallage zum gewählten thematischen Untersuchungsgegenstand aus meiner Sicht allerdings eher unbefriedigend bis wenig überzeugend dar (wie in meinen Vorbemerkungen nachzulesen). Dies trifft für die heutige Situation nun wirklich nicht mehr zu, eher das Gegenteil ist der Fall.
Ebenso besteht in der Schiller-Forschung seit nunmehr vielen Jahren eindeutig die Auffassung, dass Schiller nicht nur als Dramatiker und Dichter, sondern in gleichem Maße auch als eigenständiger und zudem wirkmächtiger Philosoph, insbesondere auf dem Gebiet der Ästhetik, Herausragendes und mithin Bedeutendes geleistet hat.
[22.02.2012 – Foto ergänzt: 26.06.2012]
Die Bedeutung des Spielbegriffs in Schillers Briefen
»Über die ästhetische Erziehung des Menschen«
Hausarbeit der Fachprüfung für das
Lehramt an Gymnasien
dem
Wissenschaftlichen Prüfungsamt Bochum
vorgelegt von
Lothar Jahn
Berichterstatter: Prof. Dr. Wilhelm Voßkamp
Bielefeld 1977
[geändert gemäß der aktuellen Rechtschreibreform: 27.01.2012]
| 1. |
|
Vorbemerkungen
Die Aufgabe dieser Arbeit scheint angesichts der Formulierung des Themas auf den ersten Blick eindeutig und klar umrissen zu sein, zumal es sich um einen einzelnen Begriff und dessen Bedeutung innerhalb der »Ästhetischen Briefe«[1] Schillers handelt und ferner die konkrete Behandlung des Begriffs im Verhältnis zum Gesamtumfang des Textes einen vergleichsweise engen Raum ausmacht[2]. Jedoch bei genauerem Hinsehen erweitert sich der zunächst eindeutig abgrenzbar erscheinende Rahmen und mit ihm das ineinander verschlungene Beziehungsgewebe des Spielbegriffs zu einer Komplexität, die letztlich das Ganze der »Ästhetischen Briefe« umfasst und eine Systematik in der Untersuchung vor nicht geringe Schwierigkeiten stellt[3].
|
| 1.1. |
|
Es sind dies Schwierigkeiten nicht allein in Bezug auf die Darlegung der Herleitung des Schillerschen Spielbegriffs im Besonderen und dessen erkenntnistheoretischer Komponente hinsichtlich der Schönheit; auch ist es nicht einzig das Aufzeigen des anthropologischen Aspekts, d. h. die Bestimmung des Spielbegriffs bezüglich der dualistischen Seinsverfassung des menschlichen Wesens in Relation zu seiner Menschheitsidee; ebenso wenig liegt die Schwierigkeit in der alleinigen Betrachtung des erkenntnispraktischen Aspekts, also in der Bestimmung der Bedeutung des Spielbegriffs für die Grundthese der »Ästhetischen Briefe« sowie der damit in engstem Konnex stehenden ästhetischen Erziehungsidee Schillers.
Die Problematik einer systematischen Darstellung der Bedeutung des Spielbegriffs liegt also nicht so sehr in einer Einzeluntersuchung der genannten Aspekte – obgleich auch diese Schwierigkeiten zu überwinden hat, insbesondere was die Schillersche Terminologie betrifft –, als vielmehr in der systematischen Bestimmung des Gesamtkomplexes des Spielbegriffs, der jene Teilaspekte in sich vereinigt und aus deren Zusammenwirken allererst die Bedeutung des Spielbegriffs schlechthin erwächst. Aufgrund dessen erscheint es zweckmäßig zu sein, trotz aller zu erhebender Einwände, den Spielbegriff in drei Einzelaspekte aufzugliedern. Zur Rechtfertigung des im Folgenden angewandten Verfahrens, der Trennung in Einzelaspekte, sollen Schillers eigene Worte in übertragenem Sinn und stark abgewandelter Form herangezogen werden: nur durch die Auflösung eines Ganzen in seine Einzelglieder ist es dem Verstand ermöglicht, diese in jenem Ganzen als vereinigt zu begreifen[4].
|
| 1.2. |
|
Die Aufgliederung gilt es bereits hier etwas genauer zu fassen, um den Verlauf der eigentlichen Untersuchung durch eingefügte erklärende Bemerkungen nicht unnötig zu stören. Die Absicht der Arbeit kann nicht darin bestehen, die Bedeutungsvielfalt des Spielbegriffs bis in jede mögliche Verzweigung dritten und vierten Grades zu verfolgen und zu analysieren.
Es wird vielmehr darauf ankommen, die wesentlichen Grundbedeutungen des Spielbegriffs zunächst hinsichtlich seiner Teilaspekte zu kennzeichnen, u. z. unter einer einem jeden Aspekt spezifisch zugeordneten Fragestellung. Erst im Anschluss daran kann eine Bedeutungsbestimmung des Spielbegriffs als Ganzem unter Berücksichtigung der Resultate der Einzelerörterungen versucht werden.
Zum Ersten ist die Frage zu stellen: Worauf gründet sich die erkenntnistheoretische Bedeutung des Spielbegriffs hinsichtlich der Erkennbarkeit der Schönheit, bzw. worin besteht die strukturelle Besonderheit des Spielbegriffs, um als Erkenntnisprinzip für die Schönheit gelten zu können und ihr dadurch zu einem verstandesmäßigen Begriff zu verhelfen?
Im Hinblick auf den zweiten Aspekt lautet die Frage: Welche Bedeutung kommt dem Spielbegriff in anthropologischer Hinsicht zu, d. h. aufgrund welcher Qualität wird dem Spielbegriff die Möglichkeit zur Überwindung des essentiellen Dualismus des Menschen in Sinnenwesen und Vernunftwesen beigemessen und darüber hinaus die Eignung zur Wesensbestimmung des Menschen zuerkannt und was folgt daraus für die Schönheit bezüglich der Realität des Menschseins?
Schließlich ist drittens zu fragen: Welche Besonderheit ist dem Spielbegriff inhärent in Bezug auf die erkenntnispraktische Komponente, d. h. die ästhetisch-moralische Erziehungsidee; was zeichnet den Spielbegriff zusammen mit seinem Gegenstand, der Schönheit, aus, um für die ästhetische Erziehung des Menschen bedeutsam werden zu können?
Dabei ist die oben angeführte Reihenfolge der einzelnen Aspekte nicht als eine notwendige Komparation zu verstehen; denn die Aussagen über einen je einzelnen Aspekt ergeben durchaus auch entscheidende Einsichten für einen jeden der übrigen. Und dies ist mitunter auch in reflexiver Relation zu sehen. In Anbetracht dessen und durch die Tatsache, dass die Einzelaspekte im eigentlichen Sinn nicht voneinander zu trennen sind – da sie in der Sache selbst nicht unmittelbar vorgegeben ist, sondern die Aspekte vielmehr ineinanderfließen und sich ergänzend überschneiden –, folglich eine strenge Grenzziehung nicht angemessen ist, werden Wiederholungen bei den Einzelbetrachtungen unvermeidbar, ja mithin notwendig sein. Damit soll angedeutet werden, dass der Grat jeder einzelnen, d. h. nur den jeweiligen Aspekt expressiv betreffenden Aspektbetrachtung nicht nur äußerst schmal ist, sondern sich in ebensolchem Maße überaus breit darstellt. Die unmittelbaren Verweisungstendenzen jedes Aspekts auf jeden der beiden anderen gilt in besonderem Maße für den als »anthropologisch« bezeichneten, der zugleich als übergeordneter wie auch als grundlegender, mithin als bedeutsamster Aspekt angesehen werden kann. Von daher mag es gewagt sein, diesen als einen gesonderten Aspekt ausweisen zu wollen. Die einzige mögliche Rechtfertigung – wie überhaupt für die Aufgliederung des Spielbegriffs – kann somit nur eine aus systematischen Gründen sein und nicht primär aus inhaltlichen. Bei der separaten Erörterung wird also darauf zu achten sein, ihre Zusammengehörigkeit im Spielbegriff selbst nicht aus dem Blick zu verlieren; denn erst zusammengenommen ergeben sie den Umfang der Bedeutung des Spielbegriffs.
|
| 1.3. |
|
Eine weitere Schwierigkeit, vor die sich eine systematische Untersuchung gestellt sieht, ist mit dem zweiteiligen Ansatz Schillers in den »Ästhetischen Briefen« gegeben. Der eine soll im Folgenden als der philosophisch-abstrakte bzw. theoretische Ansatz gekennzeichnet werden, hingegen der zweite der historisch-konkrete genannt werden soll. Der erste Ansatz nimmt eindeutig Bezug auf die kritische Philosophie Kants, während der zweite die politischen Zeitereignisse des revolutionären Frankreich gegen Ende des 18. Jahrhunderts in den Blick nimmt.
Das Problem für eine systematische Eingliederung jenes zweiteiligen Ansatzes im Hinblick auf das hier anstehende Thema besteht nun darin, dass eine ausführliche Behandlung einerseits der Auseinandersetzung Schillers mit Kant in den »Ästhetischen Briefen«, andererseits die Auseinandersetzung mit seiner Zeit den Rahmen dieser Arbeit überfordern würde. Andererseits muss hervorgehoben werden, dass durch die sowohl die Intention Schillers, die er in den »Ästhetischen Briefen« im Allgemeinen und mit dem Spielbegriff im Besonderen verfolgt, als auch deren Notwendigkeit deutlich und verständlich wird. Das bedeutet aber, dass eine gänzliche Vernachlässigung jener Ansätze der Sache des Untersuchungsgegenstandes zum Nachteil gereichte und eine Lücke in der Bedeutungsbestimmung des Spielbegriffs darstellte; was wiederum besagt, dass eine Einbeziehung unerlässlich ist. Die Berücksichtigung wird allerdings nur insoweit erfolgen, als ihnen für die Untersuchung thematische Relevanz zukommt und dem Verständnis des Gegenstandes in entscheidendem Maße förderlich ist.
|
| 1.4. |
|
Aus alldem folgt, dass der Spielbegriff aus den genannten Gründen zunächst in seinen Teilaspekten untersucht wird. Dabei werden die verschiedenen Ansätze Schillers den entsprechenden Aspekten integrativ zuzuordnen sein. Daran anschließend soll als Zusammenfassung versucht werden, den Spielbegriff in seiner Gesamtkonzeption zu bestimmen und seine Bedeutung als tätige Einheit der Erkenntnis in Bezug auf Schillers Grundthese zu charakterisieren.
|
| 1.5. |
|
Zu der Literatur, die für die Abfassung der Arbeit verwendet wurde, seien an dieser Stelle einige allgemeine Bemerkungen vorausgeschickt. Betrachtet man die überaus zahlreiche Literatur zu Schillers Werk, so muss man feststellen, dass dem Spielbegriff im Verhältnis zu anderen Untersuchungsgegenständen eine vergleichsweise nur geringe Beachtung zuteil geworden bzw. dass der Spielbegriff anderen Untersuchungszusammenhängen mehr oder weniger offensichtlich untergeordnet ist[5].
Dies gilt auch für diejenigen Arbeiten, die sich speziell den philosophisch-ästhetischen Schriften Schillers zuwenden. Für diese ist festzustellen, dass der Begriff des Spiels vornehmlich aus dem Blickwinkel anderer, für Schillers philosophische Unternehmungen als weit bedeutsamer erachtete und ihn als Ästhetiker und Philosoph als weit mehr charakterisierende Begriffe – wie etwa die Begriffe der Freiheit, der Schönheit und der Kunst - abgehandelt wird. Es sind allenthalben nur wenige Untersuchungen zu nennen, deren erklärter Gegenstand der Schillersche Spielbegriff sowie dessen Bedeutung und Tragweite ausmacht[6]. Dazu mögen im Wesentlichen zwei Gründe den Ausschlag gegeben haben: Der erste Grund ist vermutlich darin zu sehen, dass Schiller in erster Linie Dichter ist und seine ästhetisch-theoretische Betätigung zum einen im Verhältnis zu seiner dichterischen Schaffenszeit nur eine relativ kurze Zeitspanne umfasst, nämlich die Jahre zwischen 1791 und 1796, zum anderen der begrifflichen Untermauerung seiner bis dato mehr der Intuition folgenden dichterischen Tätigkeit dient. Ein zweiter Grund mag darin liegen, dass das Spiel in den übrigen theoretischen Schriften Schillers mehr oder weniger zur Beschreibung sinnlich erscheinender, psychischer wie auch materieller[7] Handlungsweisen verwendet wird und nicht annähernd die Prägnanz eines wohldefinierten Begriffs wie in den »Ästhetischen Briefen« aufweist und ihm des Weiteren nur dort eine zentrale Qualität zugewiesen wird[8]; wohingegen für die Freiheit, die Schönheit oder die Kunst in allen ästhetisch-theoretischen Abhandlungen Schillers exponierte Bedeutung nachweisbar ist.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 2. |
|
Der erkenntnistheoretische Aspekt des Spielbegriffs
Wenn der erste der drei Aspekte des Spielbegriffs der erkenntnistheoretische genannt wird, so ist mit dieser Benennung zum einen ein eng begrenzter Bereich der Erkenntnis selbst gemeint, zum anderen eine bestimmte Bedeutungskomponente des Spielbegriffs gekennzeichnet. Angesichts der Äußerung Schillers, es sei die »Sache der Schönheit«[9], die in den »Ästhetischen Briefen« behandelt werde, im Zusammenhang mit der hier aufgestellten Behauptung, der Spielbegriff besitze in den »Ästhetischen Briefen« eine zentrale Bedeutung, wird der Erkenntnis- bzw. Objektbereich des Spielbegriffs evident und schränkt die Verwendung der Bezeichnung »erkenntnistheoretisch« auf ein bestimmtes Gebiet, auf einen bestimmten Gegenstand ein.
Unter erkenntnistheoretisch wird die Bestimmung der Bedeutung des Spielbegriffs für die Erkennbarkeit der Schönheit verstanden, wodurch umgekehrt diejenigen Bedingungen, die für den Spielbegriff selbst konstitutiv sind, aufgedeckt werden, d. h. seine Elemente, Strukturen, seine Voraussetzungen und sein Vollzug für das Erkennen der Schönheit. Wird also im Folgenden von dem erkenntnistheoretischen Aspekt die Rede sein, so ist damit die im Spielbegriff in besonderer Weise strukturierte Beschaffenheit in Bezug auf die Erkenntnismöglichkeit der Schönheit gemeint.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 2.0.1. |
|
Kants Bestimmung des »freien Spiels«
In der Literatur ist vielfach darauf hingewiesen worden, dass die Deduktion des Spielbegriffs bei Schiller sich an der Kantischen Definition des »freien Spiels der Erkenntnisvermögen«[10] orientiert und durch sie entscheidende Anstöße gewonnen habe [11]. So beurteilt auch I. Heidemann das Verdienst Kants mit den Worten, dass »Kant in der Kritik der Urteilskraft den systematischen Ort für die philosophische Frage nach dem Spiel angegeben« und »Schiller nun im Zusammenhang mit Kants Bestimmungen seinen idealistischen Spielbegriff«[12] entwickelt habe.
Es soll hier nicht die Frage beantwortet werden, wieweit Schiller mit seiner Spielbegriffsdefinition über Kant hinaus gegangen ist, aber da sich in der Tat Affinitäten zu Kant aufzeigen lassen[13], ist es erforderlich, einige Überlegungen zu Kants »freiem Spiel« anzustellen, um gleichzeitig die Eigentümlichkeiten des Spielbegriffs Schillers selbst augenscheinlicher hervortreten zu lassen.
Die Rede vom »freien Spiel der Erkenntnisvermögen« steht unter der die gesamte transzendentale Kritik beherrschenden Frage nach den Möglichkeiten und den Grenzen menschlicher Erkenntnisfähigkeit. Damit ist aber für Kant notwendig die Wendung in das Subjekt verbunden, welches der alleinige Träger aller Erkenntnisvermögen ist und dessen Bewusstsein die Objektwelt aufgrund analytisch ermittelter apriorischer Prinzipien allererst zu Bestandteilen der Welt diese Bewusstseins macht. Desgleichen gilt folglich auch für die Schönheit, d. h. sie wird erst aufgrund eines besonderen Vermögens des Subjekts manifest. Und dieses Vermögen ist die ästhetisch reflektierende Urteilskraft.
Die Urteilskraft definiert Kant als die Fähigkeit, das Besondere unter das Allgemeine – eine Regel, ein Begriff, ein Gesetz – zu subsumieren. Dabei fällt die Urteilskraft in keinem Fall selbst ein Erkenntnisurteil und trägt zur Erkenntnis der Dinge nichts bei. Muss das Allgemeine erst gefunden werden, so heißt die Urteilskraft »reflektierend«. Die reflektierende Urteilskraft bezieht sich auf den Bereich des Individuellen, der Subjektivität und steigt von dort zum Allgemeinen. Reflektierend ist diese Art der Urteilskraft ferner deswegen, weil sie die Anschauung des Gegenstandes in das Subjekt zurücknimmt und dort auf dessen Gemütszustand reflektiert.
»Ästhetisch« wird diese Urteilskraft genannt, weil sie auf die Sinnlichkeit des Subjekts, d. h. darauf wie das Subjekt durch einen sinnlich wahrnehmbaren Gegenstand affiziert wird, Bezug nimmt. Diejenige Affiziertheit, die für die ästhetische Urteilskraft ausschlaggebend ist, gründet sich auf einem nur subjektiv-regulativen Prinzip: das der Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Diese nennt Kant deswegen zweckfrei, weil einerseits der Gegenstand von jeglicher Zweckgerichtetheit auf das wahrnehmende Subjekt entbunden ist und die Zweckmäßigkeit nur in der Form des Gegenstandes als subjektive vorstellig wird. Andererseits sieht das Individuum seinerseits von jeder gezielten Absicht im Sinne eines auf einen konkreten Zweck ausgerichteten Interesses bezüglich des wahrgenommenen Gegenstandes – ob aus Verstandes- oder Vernunftgründen – prinzipiell ab und ist folglich frei zu nennen.
Notwendigerweise gehört nach Kant zur ästhetisch reflektierenden Urteilskraft der Gebrauch des Verstandes, ansonsten das ästhetische Urteil keine Allgemeingültigkeit beanspruchen kann und von jeglicher intersubjektiven Mitteilbarkeit ausgeschlossen ist. Die Aufgabe der ästhetisch reflektierenden Urteilskraft besteht also neben der reflektierenden Beurteilung des subjektiven Zustandes ferner darin, das Besondere der subjektiven Empfindung – »die niemals Begriff von einem Objekt werden kann«[14] – in einem allgemein mitteilbaren, ästhetischen Urteil zu objektivieren. Ein reflektierendes Urteil nennt Kant dann »ästhetisch«, wenn die Urteilskraft erstens »keinen Begriff für die gegebene Anschauung bereit hat«[15], zweitens »die Einbildungskraft (...) mit dem Verstande (...) zusammenhält und ein Verhältnis beider Erkenntnisvermögen wahrnimmt, welches die subjektive bloß empfindbare Bedingung des objektiven Gebrauchs der Urteilskraft (nämlich die Zusammenstimmung jener beiden Vermögen unter einander) überhaupt ausmacht«[16]. Durch die beiden Attribute »ästhetisch« und »reflektierend« wird somit sowohl der Beurteilungsgegenstand, das besondere Verhältnis von Einbildungskraft und Verstand, als auch der Verfahrensmodus der Urteilskraft, die Reflexion auf dieses Verhältnis, eindeutig bestimmt.
In diesem Zusammenhang verwendet Kant die Formulierung vom »freien Spiel« und weist ihm hinsichtlich der Bestimmung der Bedingungen einer möglichen Erkennbarkeit[17] des Schönheitsphänomens seinen erkenntnistheoretisch systematischen Ort zu[18]. Dadurch, dass die Reflexion im Rückzug den Zustand des Subjekts zum Betätigungsfeld nimmt und einen Bewusstseinsprozess bewirkt, gerät das freie, das »harmonische Spiel der beiden Erkenntniskräfte der Urteilskraft, Einbildungskraft und Verstand«[19] in den Blick. Nur aufgrund der Zusammenstimmung zwischen begriffsloser Einbildungskraft und begriffsbildendem Verstand in einem freien Spielverhältnis entsteht das ästhetische Urteil. Nur indem die Verstandestätigkeit der Einbildungskraft keinen allgemein-objektiven Begriff vorschreibt, diese somit frei bleibt, und ihr eigenes Spiel mit der Vorstellung gewährleistet ist, behält auch der Verstand seine Freiheit, insofern als er nicht durch einen von ihm selbst vorgegebenen Begriff über den objektiven Gegenstand festgelegt ist, sondern allein auf die Bestimmung der ästhetischen Vorstellung im Subjekt gerichtet ist. Die Funktion des Verstandes in der ästhetischen reflektierenden Urteilskraft ist es, das die ästhetische Vorstellung konstituierende subjektiv-regulative Prinzip unter einen Begriff zu bringen. Und dieses auf einen Begriff gebrachte Prinzip ist – wie bereits erwähnt – die zweckfreie Zweckmäßigkeit in Anschauung eines Gegenstandes.
Kommt die reflektierende Urteilskraft zu dem Resultat, dass das Gefallen am Gegenstand ein freies, d. h. ein begriffsloses, uninteressiertes und zweckfreies ist, und also das Zusammenwirken von Einbildungskraft und Verstand auf einem freien Spiel beruht, so ist die Äußerung des zunächst nur subjektiv bedeutsamen Urteils zugleich auch eine allgemeingültige.
Das Verhältnis des freien Spiels zwischen Einbildungskraft und Verstand ist die erkenntnistheoretisch notwendige Bedingung für das ästhetische Urteil und damit konstitutiv für das Schönheitsurteil. In der Bestimmung des Spiels als freies Spiel liegt zugleich die erkenntnistheoretische Bestimmung einer möglichen Erkennbarkeit der Schönheit – wie gleichzeitig deren Grenze – begründet. Die Erkennbarkeit der Schönheit ist ein auf einer besonderen Konstellation von Gemütszustand einerseits und Erkenntnisvermögen andererseits basierender Bewusstseinsprozess im Individuum selbst[20]. Dieser Prozess, der durch die ästhetisch reflektierende Tätigkeit der Urteilskraft bestimmt ist und sich in einem freien Spiel entfalten muss, ermöglicht allererst die ästhetische Beurteilung eines Gegenstandes als einen ›schönen‹ bzw. die Beimessung des Prädikats der Schönheit im Hinblick auf einen Gegenstand. Da die reflektierende Urteilskraft aus den oben genannten Gründen zu keinem Erkenntnisurteil befähigt ist, ist auch das Schönheitsurteil kein Urteil der Erkenntnis bzw. des Verstandes.
Daraus folgt, dass die Schönheit selbst kein Verstandesbegriff ist und auch nicht durch einen solchen repräsentiert wird, mithin gefällt, sondern sie ist allein das Produkt aus dem freien Spiel von Einbildungskraft und Verstand.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 2.0.2. |
|
Der philosophisch-theoretische Ansatz Schillers
Mit der Bestimmung des »freien Spiels« in Beziehung auf die Beurteilbarkeit des Phänomens der Schönheit hat Kant eine wichtige Entscheidung getroffen, die in dem Schillerschen Spielbegriff und der Zuordnung der Schönheit zu diesem in vielerlei Hinsicht deutliche Spuren hinterlassen hat[21]. Erst jene, von Kant vollzogene transzendentalphilosophische bzw. erkenntnistheoretische Begründung der Schönheit durch die ästhetisch reflektierende Urteilskraft und deren konstitutives Moment des freien Spielverhältnisses zweier Erkenntniskräfte gibt Schiller das theoretische Rüstzeug an die Hand, seinen Spielbegriff zu entwickeln[22].
Der eigentliche philosophisch-theoretische Ansatz ist die von Kant aus erkenntnistheoretischen Gründen vorgenommene Definition der Begriffslosigkeit der Schönheit bzw. die Formulierung, dass nur dasjenige als ›schön‹ beurteilt werden kann, was ohne einen verstandesmäßig vorgegebenen Begriff in der subjektiven Anschauung gefällt. Schiller genügt es nicht, Schönheit könne nur verstanden werden als die Wirkung eines Gegenstandes auf die Erkenntnisvermögen und folglich sei kein objektives Prinzip der Schönheit angebbar, welches an der Struktur des Gegenstandes selbst zeigen könnte, wieso es ›schön‹ sei. Gegen diese Festlegung Kants stellt Schiller seine Hypothese, dass sich ebenso aus erkenntnistheoretischen Erwägungen heraus sehr wohl ein Begriff der Schönheit aufweisen lasse[23], wenn zuvor ein Prinzip gefunden sei, welches im Menschen einen besonders strukturierten Erkenntnis- bzw. Bewusstseinsstand bewirke. Dazu ist aber erforderlich, dem »freien Spiel« Kants eine Erkenntnisfunktion im Sinne eines Erkenntnisprinzips zu deduzieren[24] und es aus einem mehr oder weniger deskriptiven Kontext in ein konstruktives, subjektives Prinzip mit gleichzeitiger erkenntnistheoretisch objektiver Gültigkeit zu transzendieren.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 2.1. |
|
Die Herleitung des Spielbegriffs aus erkenntnistheoretischen Gründen
Es ist allerdings nicht leicht zu bewerkstelligen, den erkenntnistheoretischen Aspekt des Spielbegriffs rein von dem anthropologischen zu halten, und dies aus zweierlei Gründen: Einmal – und das muss klar gesagt werden – hat Schiller mit dem Spielbegriff keine eigentliche Erkenntnislehre aufstellen wollen[25] und diesen nicht explizit unter dem Gesichtspunkt der erkenntnistheoretischen Relevanz gedeutet[26].
Sein ästhetisch-philosophisches Interesse ist vielmehr auf die Bedingungen eines freien Menschseins gerichtet. Und damit zusammenhängend dienten ihm die theoretischen Überlegungen zum Spielbegriff in Bezug auf dessen Erkenntnisgegenstand ›Schönheit‹ dazu, der Schönheit selbst eine Verbindlichkeit bezüglich der Menschheitsidee beizulegen. Die isolierte Betrachtung des Spielbegriffs in erkenntnistheoretischer Absicht ist somit nicht ganz unproblematisch. Erst in der Zusammenschau mit den beiden übrigen Aspekten gewinnt rückwirkend auch der erkenntnistheoretische Aspekt an Verständlichkeit und Relevanz. Hinzu kommt, dass das Erkenntnisproblem der Schönheit in der Kantischen Ästhetik prinzipiell ihre endgültige erkenntnistheoretische Lösung erfahren hat und Schiller die Frage nach der möglichen Schönheitserkenntnis thematisch anders formuliert und intentionell verschieden von Kants Problemstellung fasst.
|
| 2.1.1. |
|
Schillers erkenntnistheoretisches Anliegen ist es – soweit sich das aus dem Inhalt der »Ästhetischen Briefe« erschließen lässt –, der Schönheit eine Begrifflichkeit zu sichern, sie als einen »reinen Vernunftbegriff«[27] nachzuweisen. Das erfordert zuvor einen Verstandesbegriff der Schönheit, durch den die Existenz allererst gewährleistet ist und von aller Willkürlichkeit befreit wird[28]. Ein solcher Nachweis habe »auf dem Wege der Abstraktion«[29] zu geschehen, »weil er aus keinem wirklichen Falle geschöpft werden« könne, »vielmehr unser Urteil über jeden wirklichen Fall erst berichtigt und leitet«[30]. Die benutzte Methode für den zu beschreitenden Abstraktionsweg ist die transzendentale oder wie Schiller sie nennt: der »transcendentale Weg«[31]. Die transzendentale Methode[32] gilt Schiller als der Inbegriff philosophischer Reflexion überhaupt, wenn es darum geht, »einen festen Grund der Erkenntnis, den nichts mehr erschüttern soll«[33], zu finden[34]. Die transzendentale Methode soll nach den notwendigen Bedingungen der Menschheit, nach denjenigen ihres Daseins suchen. B. Mugdan erweitert das dahingehend, dass sie – von Kant herkommend – die Menschheit als Einzelbeispiel für den allgemeineren Begriff der Erscheinungen interpretiert[35]. Folgt man dieser Auslegung, so heißt das, dass Schillers »transzendentaler Weg« die notwendigen Bedingungen ermitteln soll, die allen Erscheinungen gemein sind und diese allererst zu Erscheinungen für das Bewusstsein machen; denn die Transzendentalphilosophie gebe »sich keineswegs dafür aus, die Möglichkeit der Dinge zu erklären, sondern begnügt sich, die Kenntnisse festzusetzen, aus welchen die Möglichkeit der Erfahrung begriffen«[36] werde. Schiller ist darum bemüht, nicht die Möglichkeit der Dinge, sondern die Möglichkeit einer allgemeingültigen Erfahrung von Dingen, mithin ihre apriorischen Bedingungen zu analysieren, allerdings im Vergleich zu Kant unter anderen thematischen Vorzeichen, die jedoch erst im folgenden Kapitel zur Diskussion stehen. Schiller sagt diesbezüglich, dass »alle Wahrnehmungen zur Erfahrung, d. h. zur Einheit der Erkenntnis«[37] zu vereinigen seien, weil darin die Vorschrift bestehe, die dem Menschen »durch seine vernünftige Natur«[38] aufgegeben sei. Diese Äußerung Schillers ist von nicht zu unterschätzender Tragweite auch in Bezug auf die Bedeutung des Spielbegriffs, wie noch des Öfteren zu zeigen sein wird. Erfahrung ist also nach Schiller »Einheit der Erkenntnis«, und einen Gegen-stand erkennen heißt, »daß wir einem Zustand unseres Subjektes objektive Gültigkeit beilegen«[39].
Was Schiller tatsächlich mit der Erfahrung als die »Einheit der Erkenntnis« meint, ist schwierig auszumachen und lässt der Interpretation Raum zu Spekulationen. So könnte etwa angenommen werden, dass die derart gefasste Erfahrung der Kantischen Erfahrungserkenntnis analog sei. Das hätte aber zur Folge, dass die Erfahrung – gemäß Kant – keine strenge Allgemeingültigkeit, also auch keine Gesetzmäßigkeit, beanspruchen dürfe, somit die letzte Konsequenz des Erkenntnisprozesses, nämlich die Erkenntnis selbst, vermissen ließe und gleichsam auf halbem Wege stehen bliebe. Dass dies jedoch im Fall Schillers nicht zutrifft und die Behauptung von der formelhaften Zusammenfassung berechtigt ist, wird im Verlauf der Untersuchung belegt werden können.
An dieser Stelle sei vorwegnehmend nur soviel gesagt, dass die Dreistufigkeit des Erkenntnisprozesses in Schillers Formel kontraktiert erscheint: erstens Erfahrung als bloße Sinneswahrnehmung, zweitens Zusammensetzung von Sinneswahrnehmung und Verstandestätigkeit zur Erfahrungserkenntnis und drittens Erkenntnis als die Synthese aus Erfahrungserkenntnis und transzendentalen Prinzipien im synthetischen Urteil. Alle drei Stufen zusammen ergeben bei Schiller die ›Erfahrung‹, d. h. »Einheit der Erkenntnis«. Damit soll angedeutet werden, dass das Wort ›Erfahrung‹ die reinen logischen Prinzipien implizite enthält und diese durchweg mitgedacht werden müssen. Der Ausdruck umfasst somit die von Kant erkenntnistheoretisch dezidiert aufgewiesenen Kriterien, weshalb es Schiller unnötig und dem Anliegen der »Ästhetische Briefe« abträglich erscheinen musste, sie selbst noch definitorisch darzulegen. Der Zweck ist durch die Formel für ihn hinreichend erfüllt und gleichzeitig durch die Form seinen Absichten dienlich, sodass er seinen Gedankengang weiterverfolgen kann.
Es wurde schon gesagt, dass Schiller einen Gegenstand dann für erkannt hält, wenn einem Zustand des Subjekts objektive Gültigkeit beigelegt werden kann. Objektivität ist hinwiederum nur dann angezeigt, wenn der Erfahrungserkenntnis – im oben angegebenen Sinn – etwas zugrunde liegt, welches die objektive, d. h. die allgemeine Gültigkeit in der Bedeutung eines über das Einzelne, Subjektive und allen Individuen zu eigen Stehende beweist und folglich die Erkenntniseinheit konstituiert. Da aber auch für Schiller diese notwendig zugrunde liegende Bedingung nicht als absolute Entität in der durch die Sinne allein vermittelten Objektwelt auffindbar ist, muss die objektive Gültigkeit »eine Idee sein, die die menschliche Vernunft selbst hineinlegt in das gegebene Empfindungsmaterial, und den Inbegriff dieses gedachten Allgemeingültigen und Notwendigen nennt die Vernunft dann Gegenstand«[40], wodurch dieser dann als ein »Einheitsbegriff«[41], als etwas Zusammengesetztes vorgestellt wird, wohingegen die Empfindungen »ewig etwas Mannigfaltiges«[42] darstellen. Bei Schiller liest sich das wie folgt: »Aber aus einer bloßen Ausschließung würde in Ewigkeit keine Realität und aus einer bloßen Sinnenempfindung in Ewigkeit keine Vorstellung werden, wenn nicht etwas vorhanden wäre, von welchem ausgeschlossen wird, wenn nicht durch eine absolute Tathandlung des Geistes die Negation auf etwas Positives bezogen (...) würde (...); diese Handlung des Gemüts heißt Urteilen oder Denken, und das Resultat derselben der Gedanke«[43].
|
| 2.1.2. |
|
Sinneswahrnehmung und Verstandestätigkeit sind die an der Erkenntnis maßgeblich beteiligten Kräfte des Menschen. In antithetischer Weise entwickelt Schiller die Bereiche von Sinnlichkeit und Verstand in vielfältigen Begriffsvariationen, deren Reihenfolge nur auf lockeren Assoziationen beruhe[44] und »jedes neue polarische Begriffspaar« auf »assoziativem Wege«[45] einen sich neu einstellenden Gedanken spiegele. Sinnlichkeit und Verstand werden als »zwei entgegengesetzte Kräfte«[46] bestimmt, die auf die Erfüllung der doppelten Aufgabe drängen, nämlich »das Notwendige in uns zur Wirklichkeit zu bringen und das Wirkliche außer uns dem Gesetz der Notwendigkeit zu unterwerfen«[47]. Der Sinnlichkeit ist das Stoffliche zu eigen, während der Verstand auf das Formale gerichtet ist. Beide Kräfte, »weil sie uns antreiben, ihr Objekt zu verwirklichen«[48], also Tätigkeiten im Subjekt evozieren, belegt Schiller mit der Bezeichnung »Trieb«[49].
Mit der Identifikation der Sinnlichkeit mit dem Stofftrieb und des Verstandes mit dem Formtrieb zeigt sich ein für Schiller typisches Phänomen, welches W. Böhm »ein Gleiten der Begriffe«[50] nennt. Mit Ausführlichkeit setzt sich Schiller mit der Bestimmung des Gegensatzpaares ›Formtrieb und Stofftrieb‹ auseinander.
Stellt man die von Schiller aufgeführten Eigenschaften des Stofftriebs und des Formtriebs summarisch gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:
Der Stofftrieb geht vom »physischen Dasein des Menschen«, »von seiner sinnlichen Natur«[51] aus und beschränkt den Menschen auf Zeitlichkeit und Materie, welches »höchste Begrenzung«[52]. Sein ausschließliches Gebiet ist die Endlichkeit des Menschen. Er ist auf absolute »Realität des Daseins«, d. h. »auf einen Inhalt unserer Erkenntnisse, und auf einen Zweck unseres Handelns«[53] gerichtet. Folglich macht der Stofftrieb »nur Fälle«[54], und er kann nur Gültigkeit für ein und dasselbe Subjekt sowie für einen zeitlich begrenzten Moment beanspruchen. Ebenso verhält es sich hinsichtlich des sinnlichen Gefühls bzw. der Neigung; denn das Gute gilt nur für ein einzelnes Individuum und ist von einem momentanen, der Veränderung unterlegenen Bedürfnis abhängig. Die Vollkommenheit des Stofftriebs besteht darin, dass er »größtmöglichste Veränderlichkeit und Extensität«[55], also Vielseitigkeit in der Empfänglichkeit bzw. Mannigfaltigkeit in der Empfindung anstrebt.
Dadurch »ergreift«[56] der Mensch ein vielgestaltiges Erscheinungsbild der Welt. Der Stofftrieb ist durch Passivität gekennzeichnet, d. h. er »will bestimmt werden, er will sein Objekt empfangen«[57] und schließt folglich »aus seinem Subjekt alle Selbsttätigkeit und Freiheit«[58] aus. Dennoch misst Schiller dem Stofftrieb sowohl eine bestimmte Erkenntnis- als auch eine bestimmte Handlungsqualität bei: der Stofftrieb beziehe sich »beim Erkennen auf die Wirklichkeit« und »beim Handeln (...) auf Erhaltung des Lebens«[59]. Der Stofftrieb ist zusammengefasst durch die Kriterien der Passivität, Begrenzung und Extensität bestimmt.
Der Formtrieb stellt sich zum Stofftrieb diametral dar: Dieser geht vom »absoluten Dasein des Menschen«, »von seiner vernünftigen Natur«[60] aus und ist bestrebt, »ihn in Freiheit zu setzen«[61]. Er umfasst die Gesamtheit der Veränderung in der Erscheinung, »mithin die ganze Folge der Zeit«[62] und dringt auf Ewigkeit und Notwendigkeit, d. h. »auf Wahrheit und auf Recht«[63]. Der Formtrieb gibt »Gesetze«; wenn es die Erkenntnis betrifft, sind es »Gesetze für jedes Urteil«, betrifft es Handlungen, sind es »Gesetze für jeden Willen«[64]. Da der Formtrieb unabhängig von Veränderungen in der Zeit ist, erhebt er Anspruch auf Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit, und das Gesetz des Formtriebs erhebt seinerseits »einen einzelnen Fall zum Gesetz für alle Fälle«[65]. Der Formtrieb bedeutet »die höchste Erweiterung des Seins«[66] und sein Gebiet ist das absolute Sein im endlichen Dasein des Menschen. Die Vollkommenheit des Formtriebs besteht darin, dass er »größtmöglichste Selbständigkeit und Intensität«[67], also Einheit des Individuums und Freiheit des Geistes anstrebt. Dadurch »begreift«[68] der Mensch das vielgestaltige, passiv aufgenommene Erscheinungsbild der Welt außerhalb seiner selbst. Der Formtrieb ist durch Aktivität gekennzeichnet, d. h. er »will selbst bestimmen, er will sein Objekt hervorbringen«[69] und schließt folglich aus seinem Subjekt »alle Abhängigkeit, alles Leiden aus«[70]. Er ist »beim Erkennen (...) auf die Notwendigkeit der Dinge« und »beim Handeln (...) auf Bewahrung der Würde«[71], was soviel heißt wie, auf Identität seines Menschseins bezogen. Die charakteristischen Merkmale des Formtriebs sind somit Aktivität, Erweiterung und Intensität.
Durch jene prinzipiellen Entgegensetzungen und die Festlegung der Grenzlinien der Gebiete jener beiden Triebe wird eine Dualität manifest, die ebenso für das Gegensatzpaar ›Sinnlichkeit und Verstand‹ gilt. Mit größer werdender Anzahl der Eigenschaften tritt der Dualismus schärfer hervor und erscheint ein immer unüberbrückbarerer zu werden. Zugleich wird aber durch den Antagonismus von Formtrieb und Stofftrieb und die begrenzten Erkenntnisse, die beide Triebe einzeln, d. h. nur in dem ihnen jeweils obliegenden Bereich verschaffen, die Notwendigkeit eines beide Triebe zusammenführenden Prinzips vorbereitet. Folglich können solcherart Erkenntnisse letztendlich nicht als die Erkenntnis schlechthin angesehen werden und gereichen im Sinne der Vernunftforderung nicht zur »Einheit der Erkenntnis«, sondern sind lediglich Teilerkenntnisse zu nennen. Schiller aber ist indessen gewillt, ein Erkenntnisprinzip, ein Prinzip der Einheitserkenntnis ausfindig zu machen.
Es ist allerdings für Schiller ein Faktum[72], dass die beiden antithetisch gestimmten Triebe »den Begriff der Menschheit erschöpfen, und ein dritter Grundtrieb, der beide vermitteln könnte, ist schlechterdings ein undenkbarer Begriff«[73].
Um die ontologische Problematik einer Vereinigung von Materie und Geist, von Sinnlichkeit und Vernunft, von Stofftrieb und Formtrieb aufzulösen, verlagert Schiller die Diskussion von der Ebene der Triebeigenschaften auf diejenige der Triebobjekte: »Wahr ist es, ihre Tendenzen widersprechen sich, aber was wohl zu bemerken ist, nicht in denselben Objekten, und« - so folgert er – »was nicht auf einander trifft, kann nicht gegeneinander stoßen«[74]. Diese Differenzierung von Absichtseigenschaften und Objektgerichtetheit ist von entscheidender Wichtigkeit; denn sie ermöglicht Schiller die Konstruktion eines Vermittlungsprinzips, das er den »Spieltrieb«[75] nennt.
Wenn Schiller sagt, dass sich Formtrieb und Stofftrieb zwar tendenziös entgegenstehen, gleichsam in zwei unterschiedliche Richtungen zielen, jedoch dabei nicht auf den gleichen Objektbereich gerichtet sind, so bedeutet das zweierlei. Erstens: der Stofftrieb dringt auf Veränderung in der Zeit, was jedoch nicht heißen darf, dass auch eine Veränderung in den Grundsätzen sei; hingegen dringt der Formtrieb auf Unveränderlichkeit, was keinesfalls zur Folge haben soll, dass eine Identität in den Empfindungen herrsche. Zweitens, und dies ist das Entscheidende: beiden Trieben spricht Schiller die unbedingte Berechtigung zu, und sie sind beide für eine mögliche Erkenntniseinheit unveräußerliche und mithin notwendige Kräfte. Wo sie sich vereinzeln oder Herrschaftsansprüche über den dem jeweils anderen Trieb zugeordneten Bereich erheben, ist Einseitigkeit gegeben und Erkenntnis im eigentlichen Sinne nicht gewährleistet. In jedem Fall kann dann daraus »bloß Einförmigkeit, aber keine Harmonie entstehen, und der Mensch bleibt noch ewig fort geteilt«[76], was auf die Erkenntnis übertragen heißt, dass auch sie eine geteilte bleibt. Der wesentliche Strukturbegriff, den Schiller in diesem Zusammenhang in Anschlag bringt, ist der der »Wechselwirkung«[77] bzw. des »Wechselverhältnisses«[78]. Von ausschlaggebender Bedeutung ist er deshalb, weil durch diesen Begriff nicht nur beide Triebe als wesentliche Bestandteile und gleichermaßen wichtige Strukturelemente im Erkenntnisakt anerkannt werden, sondern sie darüber hinaus als unabdingbare Notwendigkeit zur Erkenntnis überhaupt vorausgesetzt werden. Denn – so definiert Schiller das Wechselverhältnis von Formtrieb und Stofftrieb – nur insofern der Mensch selbstständig sei, d. h. der Formtrieb wirksam wird, »ist Realität außer ihm, ist er empfänglich; nur insofern er empfänglich ist«, d. h. der Stofftrieb zur Ausübung kommt, »ist Realität in ihm, ist er eine denkende Kraft«[79].
Folglich besteht die Wechselwirkung zwischen Formtrieb und Stofftrieb in gleichzeitiger und gegenseitiger Subordination und Koordination. Das hat ferner zur Folge, dass beide Triebe in gleichem Maße Beschränkungen unterliegen, wodurch sie – und jetzt sowohl in ihren Tendenzen als auch in ihren Objekten – wechselseitig limitiert sind: »den Stofftrieb muß die Persönlichkeit« - was immer das an dieser Stelle heißen mag – »und den Formtrieb die Empfänglichkeit (...) in seinen gehörigen Schranken halten«[80]. Ein derartiges Wechselverhältnis fasst Schiller in dem dialogisch[81] strukturierten Begriff des Spieltriebs zusammen.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 2.2. |
|
Die Bedeutung des Spielbegriffs als erkenntnistheoretischer Begriff
Schiller charakterisiert den Spieltrieb folgendermaßen: »der Spieltrieb wird also bestrebt sein, so zu empfangen, wie er selbst hervorgebracht hätte, und so hervorzubringen, wie der Sinn zu empfangen trachtet«[82]. Deshalb und weil in ihm sowohl der Formtrieb als auch der Stofftrieb zusammenwirken und »einzeln betrachtet«, »einem jeden derselben (...) entgegengesetzt«[83] sei, sieht sich Schiller dazu berechtigt, den Spieltrieb »für einen neuen Trieb«[84] zu erklären[85]. Die Formulierung »neuer Trieb« ist sicherlich verwirrend und mag einer denklogischen Begriffsanalyse mitunter standhalten[86].
Dennoch: Die Neuheit des Spieltriebs beruht darin, dass dieser aus der besonderen Konstellation, in der der Formtrieb und der Stofftrieb zusammenwirken, hervorgeht. Der Spieltrieb wird von Schiller keineswegs den beiden Grundtrieben als ein weiterer und deshalb neuer Trieb beigeordnet, sodass man von drei mehr oder weniger gleichwertigen Trieben sprechen könnte. Vielmehr ist der Spieltrieb gleichsam als das Produkt der ideal vorgestellten Relation von Form- und Stofftrieb und als zu gleichen Teilen aus letzteren und nur aus diesen zusammengesetzt zu denken. D. h.: sobald Formtrieb und Stofftrieb in einem Wechselverhältnis harmonieren, in welchem sie sich nicht nur subordinativ limitieren, sondern gerade wechselseitig koordinativ erweitern, konstituiert sich der Spieltrieb und ist im selben Augenblick als neu entstandene Formation der beiden Grundtriebe anwesend. Erweiterung ist mit dem ›neuen‹ Trieb insofern gegeben, als zum einen beide Grundtriebe im Spieltrieb keinerlei unsachgemäße Restriktion durch den jeweils anderen zu befürchten haben, zum anderen dadurch, dass sie dem Bewusstsein, folglich der Erkenntnis sowohl zu höchster Vielfalt als auch zugleich zu höchster Einheit verhelfen und somit zu einer umfassenden Erkenntnis des Menschen als Objekt der Weltmannigfaltigkeit wie als Subjekt der Welteinheit die Möglichkeit geben.
Man kann also sagen, dass der Spieltrieb das apriorische Prinzip des Verhältnisses der beiden Grundtriebe des Menschen bezüglich der Erkenntnis darstellt. Gleichzeitig ist mit dem Wechselverhältnis zwischen Form- und Stofftrieb ein erstes wesentliches Charakteristikum des Schillerschen Spielbegriffs namhaft gemacht. Weiterhin hat Schiller durch die Deduktion des Spieltriebs die erkenntnistheoretische Möglichkeit einer »Einheit der Erkenntnis« formal wie auch inhaltlich, nämlich aufgrund der in ihm statthabenden dialogischen Beschaffenheit von Formtrieb und Stofftrieb auf einen Begriff gebracht.
Im Spieltrieb manifestiert sich die Erkenntniseinheit und rechtfertigt die Bezeichnung Einheitsprinzip bzw. Erkenntnisprinzip.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 2.3. |
|
Der Erkenntnisgegenstand des Spielbetriebs
Sinneswahrnehmung und Verstandestätigkeit ergeben die Erfahrungserkenntnis, d. h. die Erkenntnis von Gegenständlichkeiten durch Begriffe. Aber weder allein der Sinnlichkeit noch allein dem Verstand ist die Vorstellung der Schönheit an einem Gegenstand gegeben und führt schon gar nicht zur Erkenntnis der Schönheit.
Im Spieltrieb ist die Verknüpfung von Stofftrieb als Vermögen der Sinnlichkeit und Formtrieb als Vermögen des Denkens[87] vollzogen, und beide Grundtriebe sind auf ihre je spezifische Weise in ihm gemeinsam tätig. Das hat notwendig zur Folge, dass zugleich auch ihre jeweiligen Erkenntnisgegenstände mit einbezogen sind. Den Gegenstand des Stofftriebs, die Empfindungen, d. h. alles in den Sinnen unmittelbar Anwesende belegt Schiller mit dem umfassenden Begriff »Leben«[88]. Den Gegenstand des Formtriebs, die Einheit, d. h. die Identität des Subjekts mit sich selbst in Bezug auf die Gegenstände bezeichnet Schiller mit dem Begriff »Gestalt«[89]. Somit muss der Gegenstand des Spieltriebs jenem analog strukturiert, d. h. durch gleiche konstitutive Elemente charakterisiert sein. Ein derartiger Gegenstand ist die Summation jener beiden Einzelgegenstände, nämlich die »lebende Gestalt«[90].
Der Gegenstand »Leben« kennzeichnet die erste Stufe des dreistufig ausgewiesenen Erkenntnisprozesses und ist die Erfahrung aus erster Hand, d. h. sie beruht auf bloßer Sinneswahrnehmung. Der Gegenstand »Gestalt« hingegen stellt hier eine Zwischenstufe dar und beruht ausschließlich auf der isolierten Tätigkeit des Verstandes, d. h. er ist ein schematischer Begriff des Denkens. Der Gegenstand »lebende Gestalt« schließlich erfolgt auf der zweiten Stufe und bezeichnet die Zusammensetzung von Sinneswahrnehmung und Verstandestätigkeit, d. h. er ist das Resultat der Erfahrungserkenntnis, besitzt somit die Qualität eines verstandesmäßigen Begriffs und kann als ein Gegenstand der Erkenntnis bezeichnet werden[91].
Der in einem allgemeinen Schema vorgestellte Gegenstand des Spieltriebs diene nach Schiller zugleich »allen ästhetischen Beschaffenheiten der Erscheinungen, und mit einem Worte dem, was man in weitester Bedeutung Schönheit nennt, zur Benennung»[92]. Das Oxymoron »lebende Gestalt« besagt also, dass das Wesen der Schönheit sich in einem Zusammenspiel aus Veränderlichem, d. h. Lebensdynamischem, und Unveränderlichem, d. h. Gestaltidentischem, darstellt und als solches die gleichen Strukturmerkmale wie der Spieltrieb aufweist. Demzufolge ist die Schönheit dessen erklärter Erkenntnisgegenstand, zumal die Schönheit ihrerseits wiederum nur einem Vermögen zur Erkenntnis wird, welches Invarianz und Varianz als konstitutive Kriterien in sich zur Einheit verknüpft.
Da Schiller dasjenige, was im Wechselspiel von Reflexion mittels des Formtriebs und Empfindung mittels des Stofftriebs gegründet ist, als Spieltrieb bestimmt, bei Kant »wesentlich ästhetische Urteilskraft«[93] bedeutet, so kann der Spieltrieb, wie er sich bei Schiller präsentiert, durchaus ein spezifisches Erkenntnisvermögen bezüglich der Erkenntnis der Schönheit genannt werden.
Dadurch, dass der Spieltrieb sich erkenntnistheoretisch als Vermögen der Erkenntnis legitimieren lässt, ist mit dessen Gegenstandsbegriff, der »lebenden Gestalt«, zugleich der Schönheit eine Begrifflichkeit nachgewiesen.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 3. |
|
Der anthropologische Aspekt des Spielbegriffs
Der als anthropologisch bezeichnete Aspekt ist in vielerlei Hinsicht der bedeutsamste Gesichtspunkt des Spielbegriffs; denn dessen Perspektive ist zum einen auf den reinen Menschheitsbegriff, zum anderen auf den reinen Vernunftbegriff der Schönheit gerichtet.
Unter der Bezeichnung ›anthropologisch‹ soll die Bestimmung der Wesensbeschaffenheit des Menschen verstanden werden, insoweit sie integrierender Bestandteil der Weltanschauung Schillers im Sinne einer idealistischen Anthropologie ist. Im Besonderen beschränkt sich dabei das Umfeld des anthropologischen Aspekts auf die Erörterung der Elemente des Menschen, seiner Strukturen sowie seiner Gesetzlichkeiten. Die dadurch geschaffenen Grundlagen ergeben dann im Rückblick die Funktion bzw. Bedeutung des Schillerschen Spielbegriffs für die Wesensverfassung des Menschen.
Dies hat notwendigerweise unter dem Blickwinkel der im neuzeitlichen Denken gewonnenen Einsicht zu geschehen. Wenngleich die Auseinandersetzung mit dem Spiel und der Schönheit nicht erst mit Schillers »Ästhetischen Briefen« Eingang in die philosophische Spekulation gefunden hat[94]; so ist doch eine Bestimmung des Menschen mittels des Spiels und der Schönheit vorzunehmen erst aus dem neuzeitlichen Denken heraus ermöglicht. Es ist die seit Descartes und Leibniz errungene Erkenntnis, dass das Sein des Menschen in dessen Subjektivität gegründet ist, d. h. in dem Wissen um das Auf-sich-selbst-bezogen-Sein, als der eine Wesenszug der Subjektivität, sowie in dem Wissen um das Sich-selbst-erstreben-Wollen, als deren zweiter Wesenszug[95]. Denn mit dem Eingang der Individualität in das metaphysische Denken geht der Prozess des »ästhetischen Bewußtwerdens«[96] einher und evoziert als Folge davon Theorien der Ästhetik[97]. Die Einbeziehung »eines spezifischen ästhetischen Subjekts«[98] ist nach Meinung A. Baeumlers der alles entscheidende Unterschied der neueren Ästhetik zu allen früheren Theorien über das Schöne; denn das »bloße Nachdenken über das Schöne erzeugt noch keine Ästhetik. Erst wo ein schlechthin selbständiges ästhetisches Subjekt vorausgesetzt ist, kann der Gedanke an eine Ästhetik als eigene Wissenschaft gefaßt werden«[99]. Und weiter konstatiert A. Baeumler: »(...) erst in der ästhetischen Sphäre wird der Mensch als Mensch anerkannt, und deshalb konnte die lebendige Individualität erst innerhalb der Epoche des Geschmacks ein Gegenstand des Denkens werden«[100]. Aufgrund dessen ist eine Wesensbestimmung des Menschen auch und gerade vom ästhetischen Standpunkt aus ermöglicht. Die Bewusstheit der Individualität, zu der notwendig die Reflexion auf diese gehört, bildet dann auch die Denkgrundlage, auf der Schiller seinen Spielbegriff in Kohärenz mit dem der Schönheit bezüglich der Wesensbestimmung des Menschen konzipiert.
Der anthropologische Aspekt bezeichnet somit die Bedeutung des Schillerschen Spielbegriffs hinsichtlich der Wesensbeschaffenheit des Menschen kraft ästhetischer Implikationen.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 3.0.1. |
|
Kants Differenzierung des Menschen in Einzelvermögen
Was den anthropologischen Aspekt betrifft, liegt der philosophisch-theoretische Ansatz Schillers ebenfalls in der Transzendentalphilosophie Kants begründet.
In der Einleitung zur »Kritik der reinen Vernunft« umreißt Kant sehr genau sein Vorhaben[101]. Seine Philosophie ist die der »transzendentalen Kritik«[102] und als solche von abstrakt-analytischer Art, d. h. sie verfährt zergliedernd und gleichsam sezierend, »weil sie nicht die Erweiterung der Erkenntnis selbst, sondern nur die Berichtigung derselben zur Absicht«[103] hat. Kant sieht das kritische Geschäft als eine notwendige Vorarbeit, als ein Bereinigen des Arbeitsfeldes und Legen eines gesicherten Fundaments. Die transzendentale Kritik ist die »Propädeutik«[104] im Vorfeld zu einem – wie Kant sagt – später auszuführenden doktrinalen System. In den drei Kritiken ist es Kant darum zu tun, die Gesamtheit aller »Vermögen des menschlichen Gemüts ohne Ausnahme«[105] zu erfassen und auf ihre möglichen Prinzipien apriori hin zu analysieren. In allen drei Kritiken sucht Kant nach Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit, nach Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Erkenntnisfähigkeit überhaupt.
Kants Absicht mit der Transzendentalphilosophie kann daher in erster Linie nicht als eine Wesenbestimmung des Menschseins bezeichnet werden, sondern sie besteht vornehmlich in der systematischen Bestimmung der Möglichkeiten wie der Grenzen des menschlichen Bewusstseins und dessen erkenntnismäßiger Stellungnahme zur Welt der Erscheinungen. Zu diesem Zweck wird die Komplexität der Erkenntnisvermögen, d. h. ihre Gesamtstruktur einer Aufgliederung in Einzelstrukturen bzw. Einzelvermögen unterzogen, welche in den drei kritischen Werken ihren Niederschlag findet: erstens Erkennen als theoretische Erkenntnis, zweitens Wollen bzw. Handeln als praktische Erkenntnis und drittens Beurteilen seitens der reflektierenden Urteilskraft entweder gefühlsmäßig, d. h. ästhetisch oder verstandesmäßig, d. h. teleologisch. Nicht die Gesamtschau der Gemütsvermögen, sondern deren Einzelanalyse steht im Vordergrund der kritischen Philosophie Kants. K. H. Volkmann-Schluck fasst das mit folgenden Worten zusammen: »Kant konnte eine transzendentale Betrachtung des Menschseins niemals versuchen, da sein Denken von der Frage beansprucht war, wie Metaphysik als Wissenschaft für die endliche Menschenvernunft möglich sei.«[106]
Das Wesen des Menschen wird bei Kant zurückgenommen auf einzelne Gemüts- bzw. Erkenntnisvermögen, wodurch diese unausbleiblich in ein distanziertes Verhältnis zum lebenden Individuum geraten.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 3.0.2. |
|
Der philosophisch-theoretische Ansatz Schillers
Schiller erkennt zwar das analytische Vorgehen Kants aus systematischen Gründen als durchaus legitim und die Notwendigkeit der isolierenden Betrachtung der Kräfte des Menschen hinsichtlich spezifischer erkenntnistheoretischer Problemstellungen als unentbehrlich und überaus nützlich an[107]. Jedoch ist der auf differenzierenden Kriterien beruhenden prinzipiell unaufhebbaren Trennung der Gemütsvermögen die Gefahr der Separation der Einheit des Menschen als gleichermaßen erkennendes, handelndes und beurteilendes Wesen in Einzelkräfte inhärent und droht in einem statisch-abstrakten Begriffs- und Prinzipienschematismus dessen Seinstotalität aus dem Blick zu verlieren. Eine derartige Gefahr ist für Schiller in einer Transzendentalphilosophie latent, »wo alles darauf ankommt, die Form von dem Inhalt zu befreien, und das Notwendige von allem Zufälligen rein zu erhalten«, weil man sich daran gewöhne, »das Materielle sich bloß als Hindernis zu denken und die Sinnlichkeit, weil sie gerade bei diesem Geschäft im Wege steht, in einem notwendigen Widerspruch mit der Vernunft vorzustellen. Eine solche Vorstellungsart liegt zwar auf keiner Weise im Geiste des Kantischen Systems, aber im Buchstaben desselben könnte sie gar wohl liegen«[108].
Es ist für Schillers kontroverse Position geradezu bezeichnend, dass er in den »Ästhetischen Briefen« des Öfteren nicht etwa von Erkenntnissen, sondern lediglich von Kenntnissen sowohl bezüglich allgemeiner Philosopheme als auch hinsichtlich transzendentalphilosophischer Ergebnisse spricht[109]. Schiller will damit zum Ausdruck bringen, dass ebenfalls in dem Kantischen System die transzendentale Frage nach der Wesenseinheit des Menschen nicht in expliziter Weise zur Beantwortung gelangt sei; wie sonst wäre es für Schiller noch möglich zu fragen, woran es liege, »daß wir immer noch Barbaren sind«[110]? Das heißt, die Resultate der Einzelanalysen dürfen nicht zugleich auch deren Endpunkte ausmachen. Vielmehr müssen jene ihrerseits den Ausgangspunkt zu einem möglichen Zusammenschluss aller Wesenbestandteile in der Seinsverfassung des Menschen abgeben. Mit Nachdruck verwahrt sich Schiller gegen eine als unversöhnlich anzusehende Polarität von einerseits Sinnlichkeit und andererseits Vernunft, womit unweigerlich der Verlust des notwendigen Wissens um die letztendlich anzustrebende ganzheitliche Bestimmung des menschlichen Wesens einhergeht. Denn die Vereinzelung der Kräfte gewährleiste zwar den Fortschritt des Menschen al Gattung insofern als durch Konzentration der jeweiligen Fähigkeiten die objektiven Kenntnisse der Gattung gefördert, Lösungen spezifischer Erkenntnisinteressen gefunden und die Summe des Einzelwissens vergrößert werden; indessen gerät nach Schiller das Individuum aufgrund des Missverhältnisses zwischen Sinnlichkeit und Vernunft in Widerspruch zu seinem eigentlichen Wesen.
In Anbetracht jenes Antagonismus stellt Schiller denn auch die programmatische Frage: »Kann aber wohl der Mensch dazu bestimmt sein, über irgendeinen Zweck sich selbst zu versäumen? Sollte uns die Natur durch ihre Zwecke eine Vollkommenheit rauben können, welche uns die Vernunft durch die ihrigen vorschreibt?«[111], und er kommt zu dem Schluss, dass es falsch sein müsse, »daß die Ausbildung der einzelnen Kräfte das Opfer ihrer Totalität notwendig macht; oder wenn auch das Gesetz der Natur noch so sehr dahin strebte, so muß es bei uns stehen, diese Totalität in unserer Natur (...) wieder herzustellen«[112].
Damit hat sich Schillers philosophisch-theoretischer Ansatz erweitert. Nicht mehr nur die Aussagen einer bestimmten Theorie, diejenigen Kants nämlich, veranlassen Schiller zu einer kontroversen Position, sondern darüber hinaus die sich in der Allgemeinheit darbietende Verfassung des Menschseins. Hieraus kann im Anschluss an K. H. Volkmann-Schluck[113] Schillers implizite Leitfrage abgeleitet werden. Indem Schiller nämlich Kants transzendentale Fragestellung auf das Wesen des Menschen zurückbezieht, modifiziert er sie zu der Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit des Menschseins. Sein eigentliches Anliegen liegt somit darin, einen »reinen Begriff der Menschheit«[114] sowie einen Gegenstand zu deduzieren, an dem der Menschheitsbegriff objektiviert werden kann und im Wechselbezug zu letzterem selbst Realität gewinnt. Dieser Gegen-stand soll sich darüber hinaus als »eine notwendige Bedingung der Menschheit«[115] erweisen.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 3.1. |
|
Die Herleitung des Spielbegriffs aus anthropologische Gründen
Aus der Erörterung des philosophisch-ästhetischen Ansatzes Schillers wurde von der negativen Seite her die mögliche Bedeutungssphäre des anthropologischen Aspektes des Spieltriebs bereits in ihrer positiven Grundtendenz angedeutet. Der Mensch wurde von »beiden Legislationen«, Vernunft und Sinnlichkeit, »in Anspruch genommen«[116]. Beide gelten für Schiller als die Wesenskonstituenten des Menschen: »Das Gesetz der ersteren ist ihm durch ein unbestechliches Bewußtsein, das Gesetz der anderen durch ein untilgbares Gefühl eingeprägt«[117]. Das heißt, »in der vollständigen anthropologischen Schätzung« zähle »mit der Form«, die der Einheitsforderung der Vernunft kohärent ist, »auch der Inhalt« als »lebendige Empfindung«[118] der Vielfältigkeit der Objektwelt, die dem Individuum kraft seiner Sinnlichkeit vermittelt wird. Damit ist ein unbestreitbarer Tatbestand ausgedrückt, von dem im Hinblick auf eine Wesensbestimmung des Menschen auszugehen ist.
Galt es bei der Untersuchung der erkenntnistheoretischen Bedeutung des Spielbegriffs, diesen als ein Erkenntnisprinzip nachzuweisen, so geht es jetzt darum, im Spielbegriff zugleich auch ein Wesensprinzip im Hinblick auf die Seinsverfassung des Menschen zu extrapolieren. Aus diesem Grund genügt es auch nicht, beim Formtrieb und Stofftrieb anzusetzen, weil sie selbst kausale Ableitungen aus zwei Abstraktionsbegriffen sind.
Die Tatsache, dass Vernunft und Sinnlichkeit die beiden konstitutiven Momente des Menschen ausmachen, wird von Schiller überhöht zu einem faktischen Anspruch, dass eine Menschheit existieren soll[119]. Obgleich diese Äußerung Schillers am Ende der Spielbegriffsdeduktion steht, ist sie, der imperativischen Form entkleidet, zugleich ein unumstößlich gewisses Faktum, das apriori angenommen werden muss und ohne welches eine Wesensbestimmung des Menschen gänzlich undurchführbar wäre. Das dritte Faktum, das hier zu nennen ist, um Schillers Argumentation folgen zu können, ist die Endlichkeit des Menschen, wobei nichtsdestoweniger »das unbedingt Absolute und Unendliche (...) im endlich-menschlichen Bewußtsein wirklich« ist, »nämlich als unbedingt forderndes und in seiner bleibenden Vollendung unerreichbares Ideal seines Strebens«[120].
|
| 3.1.1. |
|
Schillers Wesensbestimmung des Menschen beginnt mit den zwei letzten Abstraktionsbegriffen: »Person« und »Zustand«[121]. Sie sind im Menschen als dem endlichen Wesen getrennt. Folglich sind beide einer Definition zugänglich. Die Person ist das Unveränderliche, das Bleibende, das Sich-selbst-stets-Identische, wohingegen der Zustand das Veränderliche, das Wechselnde, das Inkongruente ist und seinen Grund nicht in sich selbst trägt. Dem Begriff der Person ist »die Idee des absoluten, in sich selbst gegründeten Seins, d. i. die Freiheit«[122] identisch; der Begriff des Zustandes ist durch das Moment der Zeit bestimmt, denn sie ist »die Bedingung alles abhängigen Seins und Werdens«[123]. Person und Zustand stehen jedoch in keinem »Begründungsverhältnis«[124], in welchem die Person den Grund und der Zustand die Folge wäre. Denn Person und Zustand sind prinzipiell verschieden, u. z. besteht die Verschiedenheit in einer Entgegensetzung aufgrund einerseits Beharrung und andererseits Veränderung, sodass sie dem Entgegengesetzten das absolute Sein und das determinierte Werden nicht begründend gewähren. Das Verhältnis von Person und Zustand kann demnach nicht als Grund-Folge-Relation gedacht werden.
Die Trennung von Person und Zustand kommt in ihrer ganzen Schärfe zum Ausdruck, wenn Schiller sagt: »Nicht, weil wir denken, wollen, empfinden, sind wir; nicht weil wir sind, denken, wollen, empfinden wir. Wir sind, weil wir sind; wir empfinden, denken und wollen, weil außer uns noch etwas anderes ist«[125].
Angesichts der von Schiller vorgenommenen Differenzierung der beiden Geistesregionen Person und Zustand erscheint eine positive Vermittlung zwischen beiden zunächst unmöglich. Wenn aber der Zustand in der variablen Dimension Zeit angesiedelt ist während die Person die invariable Kongruenz darstellt, so ist evident, dass die bei Schiller als diametraler Antagonismus in Erscheinung tretende Spaltung von Person und Zustand nicht als eine wirkliche Entgegensetzung verstanden werden darf, insofern nicht, als Person und Zustand – umgekehrt analog der Dualität von Form- und Stofftrieb – nicht auf der gleichen gedanklichen Ebene aufeinandertreffen. Denn der endliche Mensch ist und bleibt ein in dem Kontinuum der Zeitlichkeit verhaftetes reales Wesen. Oder wie W. Janke es nennt: »Das Werden des Bewußtseins als Aufeinanderfolge von Zuständen ist in der Jetztfolge der Zeit fundiert«[126], und bei Schiller heißt das: »Ohne die Zeit, das heißt, ohne es zu werden, würde er [der Mensch; v. Verf.] nie ein bestimmtes Wesen sein«[127]. Die Person ist somit nur das Ideenschema einer selbstständigen, idealisierten Substantialität. Mit anderen Worten: die Person ist eine Vorstellung in der Idee und bewegt sich somit auf einer von jeglichen Erfahrungswerten unabhängigen Abstraktionsebene; während der Zustand im Gegensatz dazu von Erfahrungswerten in der Zeit bestimmt ist und somit der konkreten Realitätsebene bedarf.
Schiller ist sich dieser Problematik durchaus bewusst und er versucht deshalb die Divergenz der nicht identifizierbaren Ebenen dadurch zu heben, indem er die Diskussion verlagert, wodurch die Möglichkeit zu einer Überbrückung der essentiellen Gespaltenheit des Menschen vorbereitet wird. Zunächst konstatiert Schiller, dass »der Mensch nicht bloß Person überhaupt« sei, »sondern Person, die sich in einem bestimmten Zustand befindet«[128]. Diese Äußerung steht in Kontrast zu der von ihm vorher gegebenen Definition von Person und Zustand, insofern als jetzt die Person eine Enklave innerhalb der Zuständlichkeit bildet. Die Verlagerung erfolgt nun dergestalt, dass Schiller die Ebene der abstrakten Idee verlässt und in den Phänomenbereich überwechselt. An die Stelle der Nur-Idee »Person« tritt die Persönlichkeit; dieser ist als solcher nichtsdestoweniger die Geltung einer Idee beizumessen, denn sie erhält den unmittelbaren Bezug zum »absoluten Sein«[129] aufrecht. Das heißt, die Person wird keinesfalls negiert, sondern sie ist dem Menschen als »reine Intelligenz«[130] immanent. Schiller transferiert sie nur in das Zeitkontinuum, wenn er sagt: »Aller Zustand aber, alles bestimmte Dasein entsteht in der Zeit, und so muß also der Mensch, als Phänomen, einen Anfang nehmen, obgleich die reine Intelligenz in ihm ewig ist«[131]. Hieraus wird ersichtlich, warum Schiller Person durch Persönlichkeit ersetzt: die Person kann nur in der Idee begriffen werden, die Persönlichkeit hingegen kann zugleich mit der Zeitlichkeit und folglich mit dem Zustand in einen Dialog eintreten. Denn die Persönlichkeit in ihrer Verwandtschaft zur Person, zur »reinen Intelligenz« ist im Menschen als ein in der Zeit bestimmtes Wesen strukturell angelegt und erlangt nur in prozessualer Zeitlichkeit Realität: »seine Persönlichkeit würde zwar in der Anlage, aber nicht in der Tat existieren. Nur durch die Folge seiner Vorstellungen wird das beharrliche Ich sich selbst zur Erscheinung«[132].
Aufgrund des Wechsels von der Person zur Persönlichkeit und der damit vollzogenen Einbeziehung des Phänomenbereichs, also der Sinnenwelt, ergibt sich rückwirkend für die Persönlichkeit, dass sie, wenn sie »für sich allein und unabhängig von allem sinnlichen Stoff betrachtet« wird, »bloß die Anlage zu einer möglichen unendlichen Äußerung«[133] darstellt. Sie ist folglich auf Realität, auf Sinnlichkeit angewiesen, will sie nicht nur Möglichkeit zum Eintritt in ein dialogisches Verhältnis zwischen ihr und der Zeitlichkeit bleiben, sondern zur Selbstverwirklichung[134] gelangen. Dadurch, dass Schiller die Person aus ihrer in sich selbst kreisenden Absolutheit vermittels des Begriffs der Persönlichkeit herausgenommen und in einen Realitätskonnex gestellt hat, wird das Begriffspaar »Person – Zustand« als eine tatsächliche Gegensätzlichkeit bzw. Dualität im endlichen Menschen begreifbar.
|
| 3.1.2. |
|
Von hier aus erhält Schillers Rede von der »Einheit der Erkenntnis« über die erkenntnistheoretische Interpretation hinaus eine Erweiterung in anthropologischer Bedeutung. Wie gezeigt wurde, sind Person und Zustand als Abstraktionsbegriffe keiner unmittelbaren Vermittlung zugängig und können im Menschen nicht ohne Weiteres in eine Einheit überführt werden. Da aber der endliche Mensch im Zeitkontinuum eingegliedert ist und die Person im Begriff der Persönlichkeit mit dem Zustand und folglich mit der Sinnlichkeit in einen Beziehungszusammenhang treten kann, ist eine Kommunikation zwischen Persönlichkeit und Zuständlichkeit nicht mehr ausgeschlossen. Sinnlichkeit und Verstand wurden als die erkenntniskonstituierenden Merkmale des Menschen ausgewiesen; Sinnlichkeit und Vernunft gelten aber ebenso als dessen wesenskonstituierende Elemente. Desgleichen muss für Persönlichkeit und Zustand gesagt werden[135]. Der Mensch empfängt die »Materie der Tätigkeit (...), oder die Realität (...) auf dem Wege der Wahrnehmung«[136], u. z. aufgrund der apriorischen Anschauungsformen Raum und Zeit.
Raum definiert Schiller im Sinne einer Objektgröße, d. h. »als etwas außer ihm [dem Menschen; v. Verf.] Befindliches«[137] und die Zeit im Sinne einer Subjektgröße, d. h. »als etwas in ihm [dem Menschen; v. Verf.] Wechselndes«[138]. Realität bedeutet demnach ein Zusammengesetztes aus Objektgröße und Subjektgröße. Zugleich ist damit vorausgesetzt, dass das Subjekt, das wahrnehmende Individuum, im objektiven Sein als mitenthalten gedacht werden muss, bevor es sich innerhalb aller Objektivität als Subjekt selbst erkennt und begreift[139].
Da nun die Persönlichkeit substantiell von der ewig identischen Person abgeleitet ist, tritt die Veränderlichkeit der raum-zeitlichen Materie in Kontrast zur geforderten Unveränderlichkeit des Ich. Sowohl Veränderlichkeit als auch Unveränderlichkeit besitzen maßgebliche Bedeutung für das endliche Wesen des Menschen. Daraus erwächst an den Menschen die Forderung, die zugleich appellativen Charakter besitzt: »Diesen in ihm wechselnden Stoff begleitet sein niemals wechselndes Ich – und in allem Wechsel beständig Er selbst zu bleiben, alle Wahrnehmung zur Erfahrung, d. h. zur Einheit der Erkenntnis, und jede seiner Erscheinungsarten in der Zeit zum Gesetz für alle zu machen«[140]. Damit ist ausgesagt, dass durch die Persönlichkeit die Relativität des Zustandes, der wechselnden Sinnesdaten, die »Augenblicksgeltung«[141] zu dauerndem Wert erhoben werden soll. Und das wiederum heißt die Realität betreffend, dass diese nicht als fertig Gegebenes anzusehen ist, sondern dass sie erst durch die Persönlichkeit im Subjekt Erkenntniswirklichkeit werden muss. Bezüglich der »Einheit der Erkenntnis« folgt daraus, dass sie sich nur im Vollzug einer Vermittlung von Ichidentität seitens der Persönlichkeit und Veränderlichkeit seitens der Zustände erreichen lässt[142]. »Einheit der Erkenntnis«, jetzt zur Wesenseinheit erweitert, ist nur dann möglich, wenn einerseits die Sinnlichkeit dem Menschen »die Zeit erschafft«[143], d. h. dem Unveränderlichen der Persönlichkeit die Veränderlichkeit der Zeit gegenüberstellt, und andererseits die Persönlichkeit den Menschen der Zeit enthebt, d. h. »Beharrlichkeit im Wechsel behauptet«[144].
Bezeichnet man neben der Persönlichkeit auch die Sinnlichkeit als Anlage im Menschen, was durchaus vertretbar ist[145], so hat der Mensch demnach zwei Anlagen: erstens die von der Sinnlichkeit und Materie getrennte Form als »leeres Vermögen«[146] und zweitens der von »aller Selbsttätigkeit des Geistes«[147] getrennte Stoff bzw. die Materie, welche bloß Welt ist, begriffen als der »formlose Inhalt der Zeit«[148]. Die Konsequenz, die Schiller daraus zieht, lautet: um nicht bloß strukturlose Welt zu sein, muss der Mensch der Materie Form erteilen; um nicht nur leeres Vermögen, bloße Form zu sein, muss er der Form Stoff, d. h. Wirklichkeit geben. Die Wirklichkeit wiederum kann nur die Persönlichkeit des Menschen zu seiner eigenen gemacht werden.
Hierdurch hat Schiller nicht nur der gedoppelten Aufgabe des Menschen Ausdruck verliehen, sondern zugleich auch die Forderung nach »Einheit der Erkenntnis« in der Bedeutung der »vollständigen anthropologischen Schätzung« signalisiert. Die Definition von den »zwei Fundamentalgesetze[n] der sinnlich-vernünftigen Natur«[149] des Menschen, die Schiller nun gibt, steigert einerseits die Dualität des Menschen ins Extrem, andererseits lässt sie die Notwendigkeit eines Einheitsprinzips offenkundig werden. Denn der Gegensatz von Realität und Formalität dient Schiller dazu, denjenigen Begriff zu erreichen, durch den die Wesenseinheit des Menschen konstituiert, sodann die Idee der Schönheit in einen nicht nur postulierten, sondern – wie K. Hamburger sagt - »funktionellen Zusammenhang«[150] mit derjenigen der Menschheit gebracht werden kann. Das erste Fundamentalgesetz »dringt auf absolute Realität: er [der Mensch; v. Verf.] soll alles zur Welt machen, was bloß Form ist, und alle seine Anlagen zur Erscheinung bringen: das zweite dringt auf absolute Formalität: er [der Mensch; v. Verf.] soll alles in sich vertilgen, was bloß Welt ist, und Übereinstimmung in alle seine Veränderungen bringen; mit anderen Worten: er soll alles Innere veräußern und alles Äußere formen«[151].
|
| 3.1.3. |
|
Die Realität dringt auf »Verwirklichung des Wesens«[152], d. h. der Mensch soll möglichst rezeptiv, empfindend und veränderlich sein, während die Formalität im Gegensatz dazu auf »Wesensverwirklichung«[153] besteht, das bedeutet, er soll die Einheit seiner selbst überall durchsetzen und sich in allen Verhältnissen der Selbstgesetzgebung seiner selbst unterwerfen. Damit tritt die Gegenständlichkeit der zweifachen Anforderung an den Menschen mit aller Schärfe hervor; denn das Gesetz der Selbstbehauptung wendet sich gegen das Gesetz der Selbstverwirklichung, sodass man mit K. H. Volkmann-Schluck »mit Recht von einer Antinomie sprechen kann«[154].
Die aufgezeigte Gegensätzlichkeit in der Seinsverfassung des Menschen ließe sich mühelos an anderen von Schiller in seinen Gedankengang eingeführten homonymen Begriffspaaren weiter verfolgen. So kann etwa die Kategorie »Realität« durch die Begriffe »Sinnlichkeit«, »Zustand«, »Stoff«, diejenige der »Formalität« durch »Vernunft«, »Person« bzw. »Persönlichkeit«, »Form« ersetzt werden[155].
An den beiden jeweils letzten Begriffen soll die Spaltung des menschlichen Wesens noch einmal verdeutlicht werden, weil ihnen in der Herleitung des Spielbegriffs bestimmte Handlungsfunktionen zugewiesen werden, aufgrund derer Schiller die anthropologische Bedeutung des Spielbegriffs deduziert. Die Form besitzt die Seinsweise des Möglichseins bzw. Anlage oder des Vermögens in der Bedeutung einer Ermöglichung, nämlich derjenigen, die den Menschen zu dem veranlagt, was er seinem Wesen nach ist: Geist und Selbstbewusstsein. Der Stoff dagegen hat die Seinsweise des Wirklichseins im Sinne des tatsächlich Existenten, d. h. desjenigen, welches den Menschen auf die in der Grenze des Jetzt wahrnehmbare Wirklichkeit der Welt einschränkt[156]. Wichtig ist in diesem Zusammenhang mit W. Sdun darauf hinzuweisen, dass Schiller, trotz des unübersehbar endgültigen Abstandes von Form und Stoff, ihre tatsächliche Bezogenheit aufeinander erkennt und sie, die im Leben nie als gänzlich voneinander getrennt sich zeigen, nicht absolut setzt[157].
Durch jene nachgezeichneten Gegensätzlichkeiten weist Schiller auf eine notwendige Einheit hin, die zugleich auch aus der gedoppelten Anforderung eine einzige, auf das gesamte Wesen des Menschen abzielende Forderung mit imperativischem Charakter macht.
Den an den Menschen gestellten Anforderungen kann nur dann Genüge getan werden, wenn dieser sich durch entsprechende Kräfte dazu in den Stand gesetzt sieht. Diese Kräfte nennt Schiller »Triebe«[158]. Aus dem, was zuvor über die Anforderungen gesagt wurde, wird ersichtlich, was man unter Trieb im Wesentlichen bei Schiller zu verstehen hat: Trieb ist die treibende Kraft, der Antrieb bezüglich der Wesensverwirklichung des Menschen[159], und die beiden den Menschen als Grundtriebe ausfüllenden Kräfte sind bekanntlich der sinnliche Trieb oder Stofftrieb und der Formtrieb[160].
|
| 3.1.4. |
|
Mit Hilfe der detaillierten Bestimmung von Formtrieb und Stofftrieb und dem kontrastierenden Aufzeigen, dass sich beide Kräfte zwar von ihrer Tendenz her diametral entgegenstehen, aber auf einen voneinander unterschiedlichen und deshalb strikt auseinanderzuhaltenden Objektbereich zielen, vollzieht sich die Wandlung von einer Antithetik im Sinne einer nicht durch Einsicht, sondern durch oktroyierte, von außen zwanghafte Einwirkung zu einem nur scheinbaren Ausgleich gebrachte Entgegensetzung zu einer Dialogik im Sinne einer auf freier Einsicht, d. h. auf dem heautonomen Gebrauch der Vernunft fußende und durch sie zu erreichende Einheit der Gegensätzlichkeit.
Durch diesen wichtigen Unterschied hat Schiller gleichsam den theoretischen Boden bereitet, die Koinzidenz bzw. Konjunktion von Formtrieb und Stofftrieb mit dem Begriff des Wechselverhältnisses zu belegen. Mit diesem Begriff habe gemäß W. Janke Schiller »die große Revolution der Seelenverfassung (...) ins Werk gesetzt«[161] und »erwirbt ihre zentrale Kategorie: die zur Wechselbestimmung (Relation) entwickelte Einschränkung (Limitation)«[162].
In dem Wechselverhältnis der beiden Grundtriebe wird nicht allein jeder Trieb von dem jeweils anderen begrenzt in der Bedeutung einer Befreiung von jeglicher Nötigung entweder durch die Natur oder durch die Vernunft, sondern darüber hinausgehend ergänzen und befördern sie sich wechselseitig, wodurch kraft jenes Wechselspiels sich jeder einzelne Trieb gleichermaßen zu höchster Vollständigkeit und Vervollkommnung steigert[163]. Der Begriff der Wechselwirkung ist gleichsam das Gesetz der menschlichen Wesensverfassung[164] insofern als es eine »gleiche Gerechtigkeit«[165] für jede den Menschen ausmachende Kraft fordert, d. h. jeder trieb soll zugleich bestimmt werden und selbst bestimmen. Die wechselseitige Sub- und Koordination besteht demnach darin, dass die Freiheit der Persönlichkeit die Zeit bestimmt, mithin aufhebt, u. z. dergestalt, dass sie der Begrenzung durch die Jetztzeit in ihrem Gebiet alle Macht bestreitet. Dadurch aber wird die Freiheit zugleich seitens der Zuständlichkeit in der Zeit begriffen, weil diese nämlich ihr zugesprochenes Eigenrecht im Bereich der Zeit zu wahren bestrebt ist. Von hier aus ist leicht einzusehen, warum das Verhältnis von Formtrieb und Stofftrieb eher als Dialogik, denn als Antithetik zu bezeichnen ist.
Die Wechselwirkung stelle – so Schiller – »im eigentlichen Sinne des Wortes die Idee seiner Menschheit«[166] dar. »Idee« nennt Schiller das Wechselverhältnis deshalb, weil sie ein »Unendliches«[167] ausdrückt, der sich der Mensch in der Zeit nur asymptotisch zu nähern vermag.
Mit der Bestimmung der notwendigen Korrelation der beiden Grundtriebe für die Wesenseinheit des Menschen hat Schiller mit der ihm »eigenen Auslegung der Kategorie des Wechsel-Tun-und-Leidens die geglückte Verfassung der Menschheit«[168] aufgezeigt. Dennoch besitzt die Struktur des Verhältnisses letztlich nur einen metaphysischen Deskriptionswert und nicht etwa die Qualität eines transzendentalphilosophisch legitimierten apriorischen Prinzips. Das führt Schiller dahin, die Idealität der Wechselbeziehung zwischen den Trieben als eine vollständig simultane Erfahrung zu beschreiben. Nur in einer, jeder zeitlichen Abfolge enthobenen Erfahrungsweise, wo sich der Mensch »zugleich seiner Freiheit bewußt würde, und sein Dasein empfände, wo er sich zugleich als Materie fühlte, und als Geist kennen lernte«[169], sei ein vollständiges Bewusstsein gewährleistet.
Aus diesem Konjunktiv leitet Schiller schließlich das alles entscheidende apriorische Prinzip ab, in dem beide Triebe zusammenwirkend begriffen sind. Aus der Vereinigung der gegeneinander strebenden Grundtriebe entsteht der zunächst hypothetisch angesetzte Trieb, das Einheitsprinzip, u. z. dergestalt, »daß sie durch ihre Vereinigung selbst zu jenem Dritten werden«[170]. Ein solches einheitsstiftendes Prinzip ist der Spieltrieb; denn in ihm ist die Kategorie des Wechselverhältnisses ebenso wie diejenige des eigentümlichen Zeitentzugs anwesend.
Betrachtet man den Umfang der Diskussion Schillers zu dem Spielbegriff im Vergleich zu derjenigen des Dualismus der Wesensbeschaffenheit des Menschen, so ist festzustellen, dass erstere relativ geringen Ausmaßes ist; und es ist angesichts dessen schwerlich einzusehen, weshalb dem Spielbegriff demnach – wie hier behauptet wird – eine zentrale Bedeutung beigemessen werden kann[171].
Es ist aber dabei zweierlei zu beachten: Erstens stellt die Benennung »Spieltrieb« selbst schon den vollen Sachverhalt dar, weshalb Schiller auf eine detaillierte Analyse des Spieltriebs selbst verzichtet und stattdessen auf den allgemein rechtfertigenden Sprachgebrauch verweist[172]. Zweitens hat die Summe aller von Schiller aufgezeigten Gegensätzlichkeiten, die den Dualismus im Menschen in extremer Weise zuspitzten und in der Frage kulminierten: »Wie werden wir also die Einheit der menschlichen Natur wieder herstellen, die durch diese ursprüngliche und radikale Entgegensetzung völlig aufgehoben scheint?«[173], letztendlich zur Deduktion des Spielbegriffs als Einheitsprinzip geführt.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 3.2. |
|
Die Bedeutung des Spielbegriffs als anthropologischer Begriff
Notwendigkeit wird als Nötigung nur dort vorstellig, wo ihr ein Widerstand entgegentritt, der zudem die Möglichkeit des Zufalls zulässt. Andererseits kann Zufälligkeit auch nur im Umfeld von Regel und Gesetz auftreten. Folglich sind Notwendigkeit und Zufälligkeit korrelative Begriffe[174]. Der gleiche Sachverhalt gilt auch für Form- und Stofftrieb; denn das Gegeneinander der beiden Triebe ermöglicht den Zufall, weil – so formuliert K. H. Volkmann-Schluck – die Idee der Selbstbestimmung es sei, »die uns vom Gesetz des Stofftriebs zugleich freihält, und umgekehrt ist es der Stofftrieb, der uns von der Idee der Selbstbestimmung abweichen«[175] lasse. Im Spieltrieb nun herrscht dasjenige Verhältnis, in welchem die »Urkräfte«[176], d. h. die Triebe des Menschen einander nicht ungebührlich trennen oder gar durch Grenzüberschreitungen sich gegenseitig ihrer Rechtmäßigkeit berauben. Vielmehr befinden sie sich in einem freien Dialog mit sich selbst und untereinander, indem sie von jedem Zwang seitens ihrer eigenen Beschaffenheit wie auch seitens des jeweils anderen Triebs dialogisch in Freiheit gesetzt sind. Dadurch wird nach Schiller letztlich sowohl die Notwendigkeit als auch zugleich alle Zufälligkeit aufgehoben.
Die von Schiller geforderte »Einheit der Erkenntnis« erfüllt sich demzufolge darin, dass die äußere Nötigung des Zustands und der innere Selbstzwang der Person im Spieltrieb sich verlieren. Zugleich ist damit angezeigt, dass die im Spieltrieb vollzogene Einheit keine Verengung ist, sondern im Gegenteil gerade durch die Vereinigung der Beschaffenheitsmerkmale des Menschen aufgrund der dialogischen Struktur des Spieltriebs im höchsten Maße »Erweiterung«[177] der Erkenntnis und folglich des Menschseins bedeutet. Aus jener Einheit, die K. H. Volkmann-Schluck treffend »höhere Notwendigkeit«[178] nennt, gehe die wahre Freiheit hervor – »eine Freiheit, die ihr Gesetz nicht mehr gegen die Natur durchsetzt und deshalb für uns Selbstzwang ist, sondern die Natur in die freie Zustimmung zum Gesetz freiläßt«[179] und die folglich dazu berechtigt ist, »jede seiner [des Menschen; v. Verf.] Erscheinungsarten in der Zeit zum Gesetz für alle Zeiten zu machen«[180].
|
| 3.2.1. |
|
Setzt man an die Stelle von Zustand »Zeitbezug« und an diejenige von Person »Zeitentzug« – um zwei Ausdrücke W. Jankes zu benutzen[181] –, so ergibt sich neben dem in einem anderen Zusammenhang bereits genannten Kriterium der Wechselwirkung ein zweites wichtiges Merkmal des Spieltriebs hinsichtlich der Wesensverfassung des Menschen, das Schiller mit folgenden Worten definiert: »der Spieltrieb also würde dahin gerichtet sein, die Zeit in der Zeit aufzuheben, Werden mit absolutem Sein, Veränderung mit Identität zu vereinbaren«[182].
Aufgrund seiner Zuständlichkeit ist der Mensch ein in das Zeitkontinuum eingegliedertes Wesen; aufgrund seiner Personalität ist er der Kontinuität der Zeit ausgegliedert. Da der Mensch zum einen endlich ist, zum anderen sowohl Zustand wie Person wesenskonstituierend sind, hieße in der ausschließenden Jetztzeitlichkeit verhaftet sein, seine Selbstbezogenheit negieren wie andererseits in der einschließenden Allzeitlichkeit seine Weltbezogenheit verlieren. Folglich zeigt der Mensch ein »zweifaches Verhalten zur Zeit«[183]. Die notwendig geforderte Einheit, in der Selbst und Welt, Person und Zustand, Form und Stoff, in welcher also die Möglichkeit der Form ebenso verwirklicht ist, wie die Wirklichkeit der Materie in dem Vermögen der Form anwesend bleibt, ist allein im Spieltrieb erfüllt. In ihm verwirklicht der Mensch sein Ichbewusstsein durch das Anwesendsein in der Zeit; in gleichem Maße verwirklicht er sein Wesen[184], sobald er der Abfolge der Zeit entsagt, d. h. »jede seiner Erscheinungsarten in der Zeit zum Gesetz für alle Zeiten«[185] macht. Das Aufheben der Zeit in der Zeit bedeutet folglich nicht, dass die unendliche Zeitfolge als apriorische Anschauungsform geleugnet werden soll; denn das bleibt für Schiller unbestreitbar: »Ehe wir den Augenblick haben, gibt es überhaupt keine Zeit für uns; aber ohne die ewige Zeit würden wir nie eine Vorstellung des Augenblicks haben«[186]. Das heißt, die Aufhebung stellt innerhalb der endlosen Reihe des Zeitkontinuums einen zeitlich begrenzten Augenblick dar, in welchem die Zeit insofern aufgehoben ist, »als er nicht mehr aus sich heraus auf ein Dann und nicht mehr zurück auf ein Damals verweist«[187]. In einem solchen Augenblick ist der Mensch ganz in die gegenwärtige Anwesenheit zurückgenommen. Weder die Jetztzeit selbst noch ihre Abgrenzung gegenüber der Vergangenheit wie der Zukunft wird in der Sphäre des Spieltriebs als Beschränkung empfunden, »so daß alle seine Kräfte in höchster Weise regsam«[188], mithin dialogisch zwischen »Zeitbezug« und »Zeitentzug«, zwischen Jetztzeit und Allzeit zu höchster augenblicklicher Wirksamkeit in der Einheit des Menschen freigelassen sind. Kraft des Spieltriebs unterliegt der Mensch weder der Zeitnötigung in Bezug auf sein Selbstbewusstsein noch der Zeitentsagung in Bezug auf sein Weltbewusstsein.
|
| 3.2.2. |
|
Es muss ausdrücklich betont werden, dass der Spieltrieb trotz allem eine gedankliche Konstruktion Schillers ist, d. h., er ist in seiner postulierten Idealität keinesfalls ein in der Wesensstruktur des Menschen selbst vorgegebener bzw. präexistenter und durch einen entsprechenden Impuls zur Ausübung zu bringender Wesenstrieb[189]. Die Vernunft ist es, die »aus transcendentalen Gründen die Forderung» aufstellt, dass »eine Gemeinschaft zwischen Formtrieb und Stofftrieb, das heißt ein Spieltrieb sein soll, weil nur die Einheit der Realität mit der Form, die Zufälligkeit mit der Notwendigkeit, das Leiden mit Freiheit den Begriff der Menschheit vollendet«[190]. Folglich ist der Spielbegriff ein transzendentaler Begriff, der keiner unmittelbaren Erfahrung entnommen werden kann, sondern sich auf die Bedingung möglicher Erfahrung, auf die der Erfahrung vorangehende Voraussetzung bezieht, welches in der Terminologie Schillers »Einheit der Erkenntnis« bedeutete. Er ist gleichsam die apriorische Kontamination zweier Katalysatoren, Formtrieb und Stofftrieb, und stellt die auf einen einzigen Begriff gebrachte doppelte Aufgabe des Menschen vor: die Verwirklichung seines Wesens und zugleich seine Wesensbehauptung, folglich die Selbst-Verwirklichung seines Menschseins.
Der Begriff des Spiels ist die begriffliche Integration der Wesenskonstituenten des Menschen und ist somit der »reine Begriff der Menschheit«[191] im Sinne eines synthetischen Begriffs apriori, was sich bei Schiller in dem bekannten Wort ausdrückt: »Denn, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt«[192].
Aufgrund dessen und der aufgezeigten dialogischen Struktur des Spielbegriffs, nämlich die essentielle Dualität des Menschen in Weltgebundenheit und Selbstsein, Stofftrieb und Formtrieb, Zustand und Persönlichkeit, Sinnlichkeit und Vernunft, Größen-Einheit und Ideen-Einheit ausgleichend und zugleich ihre jeweiligen Charakteristika in einem harmonischen Wechselverhältnis zu höchster Entfaltung bringend zu versöhnen, kann ihm mit Recht eine anthropologische Bedeutung in Bezug auf die Wesensbestimmung des Menschen interpretiert werden. Der Spieltrieb ist schließlich als das apriorische Wesensprinzip bezüglich der subjektiven Seinsverfassung des Menschen aufzufassen.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 3.3. |
|
Der Bestimmungs- bzw. Wesensgegenstand des Spieltriebs
Mit der Darlegung des Spieltriebs als Wesensprinzip ist jedoch nur erst der im Subjekt lokalisierte Bestimmungsgrund des menschlichen Wesens im Sinne eines reinen Menschheitsbegriffs aufgezeigt. Seit Kant verlangt aber jeder Begriff nach einer Realisierung durch eine ihm adäquate Anschauung. Für die Begriffe der Vernunft, d. h. die Ideen, und als eine solche hat sich der Spielbegriff erwiesen, ist die einzige Möglichkeit, nämlich ein Übersinnliches zu versinnlichen, die des Symbols[193]. Das bedeutet für Schillers Menschheitsbegriff, dass er zu seiner Sicherung einer symbolischen Darstellung in einem adäquaten Objekt bedarf[194].
|
| 3.3.1. |
|
Der Erkenntnisgegenstand des Spieltriebbegriffs war – so hatte sich gezeigt – die Schönheit. In erkenntnistheoretischer Hinsicht wurde von Schiller der Schönheit vermittels der Kategorie der »lebenden Gestalt« eine Begrifflichkeit deduziert und die Notwendigkeit dessen in der Untersuchung erklärt. Schiller ist es jedoch in erster Linie darum zu tun, nicht einen Verstandesbegriff, sondern einen »reine[n] Vernunftbegriff der Schönheit«[195] nachzuweisen, wodurch die Schönheit den reinen Menschheitsbegriff in der Anschauung, d. h. im Objektiven zur Darstellung zu bringen in die Lage versetzt wäre; und zwar dergestalt, dass durch sie dem Menschen die »Idee seiner Menschheit«, die mit der Idealität des Wechselspiels aufgestellt und im Spieltrieb begrifflich wurde, vergegenwärtigt wird. In der Schönheit, von Schiller als »lebende Gestalt« definiert, hätte der Mensch dann die »vollständige Anschauung seiner Menschheit«[196], nämlich »das Symbol seiner ausgeführten Bestimmung«[197]. Denn, so kann mit W. Janke interpretiert werden, »in Wahrheit ist das Schöne allein in einem Zusammenhang von Leben (Empfindungsgehalt) und Form (Wasgehalt) des Gegenstandes, in welchem Leben und Gestalt einen neuen Sinn erhalten, angemessen zu erfassen«[198]. »Nur indem seine[199] Form in unserer Empfindung lebt, und sein Leben in unserem Verstande sich formt, ist (...) lebende Gestalt«[200], sagt Schiller. Damit ist angezeigt, dass die Gestalt in den Empfindungen nicht nur deshalb lebt bzw. der Mensch sich seiner Einheit nicht nur dadurch gewiss wird, dass das Denken, indem es sich der Empfindungsvielfalt entgegenstellt, auf sich und in sich selbst zurückfällt, sondern dadurch, dass der Mensch die Einheit seiner selbst gerade in der Vielfältigkeit der Empfindungen findet, erfährt und als solche verwirklicht. Denn die lebende Gestalt bilde »ein Eines, das sich nicht durch Entgegensetzung gegen die Vielfalt durchhält, sondern sie ist eine Einheit im Sinne der Harmonie, die um so mehr Einheit ist, je vielfältiger das Viele ist«[201].
Wenngleich »lebende Gestalt« ein Begriff ist, so ist das bei Schiller nicht so zu verstehen, als sei die Vielfältigkeit der Anschauung erst durch die Verstandestätigkeit, d. h. durch die Allgemeinheit jenes Begriffs zur Einheit gebracht; denn dann wäre die Gestalt ohne Leben. Erst wenn in der Anschauung das Vermögen der Empfindung und dasjenige des Denkens so zusammenstimmen, d. h. sich in einem freien Wechselspiel befinden[202], dass die Empfindung kraft der Reflexion vertieft und das Denken seitens der Empfindung belebt wird, erst dann ist die Gestalt lebend.
In der Anschauung der Schönheit verhalten sich Denken und Sinnlichkeit belebend und stärkend zueinander, »und die sinnlich-geistige Doppelnatur des Menschen gelangt nach beiden Seiten einheitlich zur höchsten Wirksamkeit und Wirklichkeit«[203].
|
| 3.3.2. |
|
Das besagt nun Folgendes: Der in Einzelkräfte zerstückte Mensch ist dazu aufgefordert seine Wesenseinheit wieder herzustellen, sich der »Idee seiner Menschheit« so weit als möglich zu nähern. Das Wesen des Menschen setzt sich zusammen aus Person bzw. Form bzw. Freiheit und Zustand bzw. Stoff bzw. Zeitgebundenheit. Im »Ideal des Spieltriebs«[204] sind alle diese Wesenselemente in vollkommener Harmonie miteinander verknüpft und gemeinsam tätig; mithin ist in ihm die Menschheitsidee in Annäherung realisierbar. Dadurch ist der Mensch von allen Zwängen frei. Die Schönheit ist ebenfalls in ihrer Idealität als vollkommene Einheit zweier Elemente definiert. Berücksichtigt man nun noch, dass ein Vernunftbegriff einer symbolischen Darstellung bedarf und das Symbol selbst eine Idealität darstellt, so ist jetzt leicht einzusehen, dass die Schönheit als »lebende Gestalt« in ihrer Idealvorstellung ebenfalls ein Vernunftbegriff ist und aus »der Möglichkeit der sinnlich-vernünftigen Natur«[205] des Menschen gefolgert werden kann.
Die Schönheit ist somit der objektive Vernunftbegriff in Bezug auf die Wesensstruktur des Menschen, d. h. die Schönheit ist »der Vernunftbe-griff spezifisch menschlicher Schönheit«[206]; denn – so kann jetzt Schillers vormals angeführtes Zitat in der richtigen Weise vervollständigt, nämlich auf den Menschen übertragen werden - »ein Mensch, wiewohl er lebt und Gestalt hat, ist darum noch lange keine lebende Gestalt. Dazu gehört, daß seine Gestalt Leben und sein Leben Gestalt sei. Solange wir über seine Gestalt bloß denken, ist sie leblos, bloße Abstraktion; solange wir sein Leben bloß fühlen, ist sie gestaltlos, bloße Impression. Nur indem seine Form in unsrer Empfindung lebt, und sein Leben in unserm Verstande sich formt, ist er lebende Gestalt, und das wird überall der Fall sein, wo wir ihn als schön beurteilen«[207].
Denkt man sich angesichts dessen den Menschen als ein zu beurteilendes Objekt, so fordert dieses seinerseits ein zur Beurteilung entsprechendes Subjekt[208]. Und ein solches dazu befähigtes Subjekt ist ein Mensch, der »in voller Bedeutung des Worts Mensch«, d. h. »ganz Mensch«[209] ist, und das wiederum ist er dann und nur dann, wenn der Spieltrieb in ihm Wirklichkeit wird und seine beiden Grundtriebe im Einklang harmonieren. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass die Anschauung der Schönheit eine Einheit in der Wesensstruktur des Menschen zur Voraussetzung hat, ja dass die Schönheit durch das Wesensprinzip Spieltrieb entscheidend konstituiert ist.
Die Schönheit ist also aus folgendem Grund ein Vernunftbegriff: einerseits, weil sie sich mit Denknotwendigkeit aus dem Begriff einer gleichermaßen sinnlichen wie vernünftigen Wesensverfassung erschließt; andererseits, weil umgekehrt der Vernunftbegriff selbst in einer solchen bereits enthalten ist, sodass mit der Idee der Menschheit zugleich auch die Idee der Schönheit gegeben ist[210]. Der Vernunftbegriff der Schönheit ist aus einer Analogie zur Wesensstruktur des Menschen über das auf diesen bezogene Strukturprinzip der »lebenden Gestalt« hervorgegangen bzw. hat sich gleichsam aus der Übertragung des Menschheitsbegriffs auf ein Objekt ergeben. Folglich ist die Schönheit die vernunftgemäße Objektivation des Wesensprinzips, nämlich des Spieltriebs. Spieltrieb und Schönheit treffen sich in dem gemeinsamen Formprinzip »lebende Ge-stalt«, wodurch diese im Objekt, in der Anschauung für das Subjekt das Sinnbild seines eigenen Menschseins zur Darstellung bringt und somit als dessen Symbol figuriert.
Aufgrund des Nachweises, dass die Schönheit ein Vernunftbegriff ist, ist es jetzt möglich, die letzte Stufe des in der Schillerschen Formel von der Erfahrung als »Einheit der Erkenntnis« zusammengezogenen dreistufigen Erkenntnisprozesses aufzuzeigen. Setzt man nämlich anstelle der allgemeinen apriorischen Anschauungsformen Raum und Zeit, die seit Kant für jede Gegenstandserkenntnis konstitutiv sind, die Anschauungsformen Gestalt und Leben, die dem Erkenntnisgegenstand des Spieltriebs erwiesenermaßen als besonders notwendig sind, so ergibt das die Erfahrungserkenntnis, d. h. den synthetischen Gegenstandsbegriff »Schönheit«.
Die dritte Stufe ist nun insofern erreicht, als der Schönheitserkenntnis ein synthetisches Urteil zugrunde liegt. Das heißt, das Schönheitsurteil beruht auf der Synthese aus Erfahrungserkenntnis und der transzendentalen Idee der Menschheit bzw. dem transzendentalen Prinzip des Wechselverhältnisses.
|
| 3.3.3. |
|
Dennoch ist durch das Vorhergehende noch nicht vollends geklärt, inwieweit die Schönheit bzw. deren Vernunftbegriff im anthropologischen Verständnis von Schiller »als eine notwendige Bedingung der Menschheit«[211] postuliert werden kann. Es ist dem Inhalt der »Ästhetischen Briefe« nicht zu viel zugemutet, wenn man sagt, dass Spieltrieb und Schönheit in der Auffassung Schillers sich als anthropologisch korrelative Begriffe erweisen. Das ist allein schon zwei Äußerungen Schillers deutlich zu entnehmen. Die erste lautet: »Sobald sie [die Vernunft; v. Verf.] (...) den Ausspruch tut: es soll eine Menschheit existieren, so hat sie eben dadurch das Gesetz aufgestellt, es soll eine Schönheit sein«[212]; während es in der zweiten heißt: »aber durch das Ideal der Schönheit, welches die Vernunft aufstellt, ist auch ein Ideal des Spieltriebs aufgegeben«[213]. Einmal wird die Schönheit kausal durch die Menschheit, die gleichsam den Titel für den Menschen als Wesenseinheit kraft des Spieltriebs abgibt, determiniert; das andere Mal ist umgekehrt die Schönheit die Voraussetzung für den Spieltrieb, folglich für den Menschen[214].
Aufgrund jener gegenseitigen Bedingtheit von Spieltrieb und Schönheit liegt es nahe, die Beziehungsmäßigkeit zwischen beiden als eine Wechselbeziehung auszulegen: Spieltrieb und Schönheit sind gleichzeitig und wechselseitig ihre Ursache und ihre Wirkung. Und dieses Wechselverhältnis kann durchaus in Analogie zu demjenigen im Spieltrieb zwischen Form- und Stofftrieb einerseits und demjenigen in der Schönheit zwischen Form bzw. Gestalt und Stoff bzw. Leben andererseits gesehen werden. Erwuchs aus dem Wechselspiel von Form- und Stofftrieb das Wesensprinzip des Spielbegriffs und ergab dasjenige von Gestalt und Leben das Formprinzip der Schönheit, so geht mit Konsequenz aus der Wechselbeziehung von Spieltrieb und Schönheit das Menschheitsprinzip des Menschen, d. h. das Prinzip des Menschseinkönnens hervor.
Dadurch, dass erstens in der »lebenden Gestalt«, also der Schönheit, gleichsam die Menschheitsidee symbolisiert zur Anschauung, zur Darstellung am Objekt gelangt; zweitens umgekehrt das Schönheitsobjekt durch das Formprinzip auf die Verfassung des Menschen eine analog strukturierte Wirkung ausübt wie der Spieltrieb im Menschen eine die Antinomien der Kräfte aufhebende Funktion innehat: nämlich sowohl die einer Limitation als auch gleichermaßen die einer Kräfteerhaltung und Entfaltung der Kräfte im Subjekt; drittens schließlich die Möglichkeit der Reflexion für das Individuum bei der Betrachtung des Gegenstandes auf die Idee seiner eigenen Menschheit gegeben ist, ist Schillers Postulat, dass die Schönheit sich als notwendige Bedingung des Menschen aufweisen lassen müsse, letztlich als bewiesen zu betrachten.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 3.4. |
|
Spielbegriff und Schönheitsbegriff als wesensbestimmende Begriffe des Menschen
Die Wesensbestimmung des Menschen stellt sich bei Schiller als eine zweiteilige dar: Der erste Teil, der als der subjektive der Wesensbestimmung bezeichnet wurde, erfolgte durch die Bestimmung des Spieltriebs als Wesensprinzip des Menschen; der zweite, der jetzt der objektive Teil der Wesensbestimmung genannt werden kann, wird durch den Nachweis des Vernunftbegriffs der Schönheit als Wesensgegenstand des Menschen gegeben. Beide Bestandteile der Wesensbestimmung sind zudem in dem Formprinzip »lebende Gestalt« zusammengedacht und stehen somit in nahtloser, wechselseitiger Kohärenz.
Dadurch ist nicht nur dem Spielbegriff seine anthropologische Relevanz nachgewiesen, sondern gleichzeitig auch der Schönheitsbegriff in einen anthropologischen Kontext gestellt worden[215]. Denn die Schönheit zeigte sich als die notwendige Bedingung der Menschheit, u. z. deshalb, weil sie die notwendige Objektivation des synthetischen Integrationsbegriffs des Spieltriebs dargestellt und somit rückwirkend dessen anthropologische Bedeutung in entscheidendem Maße objektiv vervollständigt.
Die Wesensbestimmung des Menschen aufgrund des Begriffs des Spiels und des Begriffs der Schönheit, also die Bestimmung des Menschseins »in der vollständigen anthropologischen Schätzung« liest sich denn auch bei Schiller wie folgt: »Nun spricht aber die Vernunft: das Schöne soll nicht bloßes Leben und nicht bloße Gestalt, sondern lebende Gestalt, das ist, Schönheit sein; indem sie ja dem Menschen das doppelte Gesetz der absoluten Formalität und der absoluten Realität diktiert. Mithin tut sie auch den Ausspruch: der Mensch soll mit der Schönheit nur spielen, und er soll nur mit der Schönheit spielen.
Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.«[216]
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 4. |
|
Der erkenntnispraktische Aspekt des Spielbegriffs
Der dritte und letzte zu behandelnde Einzelaspekt des Spielbegriffs soll im Gegensatz zum erkenntnistheoretischen der erkenntnispraktische genannt werden. Erkenntnispraktisch ist er deshalb, weil Schiller die Resultate seiner Untersuchungen über das Schöne und die Kunst[217] mit dem vielsagenden Titel »Über die ästhetische Erziehung des Menschen« überschrieben hat und dadurch ein auf Realität bzw. Realisierung hin tendierendes Moment von vornherein signalisiert ist; ferner deshalb, weil die »Ästhetischen Briefe«, mit K. H. VolkmannSchlucks Worten, »eine bestimmte Bildungsidee, jene nämlich, deren Schwund die leere Stelle hinterläßt, die man heute mit einem Chaos von Bildungstheorien vergeblich auszufüllen sucht«[218], begründen, innerhalb derer der Spielbegriff eine besondere Position und Bedeutung einnimmt.
Letzteres beinhaltet zugleich auch den Grund dafür, warum das determinierende Wort der Aspektbezeichnung weiterhin das der Erkenntnis ist und der Aspekt als der erkenntnispraktische bezeichnet wird. Denn Schiller hat weder in den »Ästhetischen Briefen« als Ganzem noch in dem Spielbegriff als Besonderem eine Bildungstheorie vorgelegt im Sinne eines didaktisch-methodischen, mithin bildungspraktischen Erziehungsprogramms. Zudem ist die Bildungsidee eine Vernunftidee, d. h. eine auf dem Gebrauch der praktischen Vernunft beruhende Erkenntnis, die zwar gemäß dem Kantischen Diktum in der Tat mit der Erfahrung[219] anhebt und der folglich ein Wirklichkeitsbezug immanent ist, aber nichtsdestoweniger Vernunfterkenntnis bleibt.
Der Gegensatz des erkenntnispraktischen Aspekts zum erkenntnistheoretischen im Fall des Spielbegriffs besteht nun darin, dass dieser von jeglicher möglichen Anwendbarkeit abstrahiert war und lediglich die rein theoretische Bedeutung des Spielbegriffs bezüglich der Schönheitserkenntnis zum Inhalt hatte, während der erkenntnispraktische – wenn auch nach wie vor vom Standpunkt der Theorie aus – den anwendungsorientierten Bezug des Spielbegriffs im Hinblick auf die Möglichkeit einer realen Selbstverwirklichung des Menschen mitbeinhaltet. Wenn also im weiteren Verlauf von dem erkenntnispraktischen Aspekt des Spielbegriffs die Rede sein wird, so ist damit die Bedeutung des Spielbegriffs für die Bildung des Menschen im Sinne einer ästhetischen Erziehung gemeint.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 4.0.1. |
|
Kants Trennung von Ästhetik und Moral
Wiederholt ist bereits darauf verwiesen worden, dass Kants Bestreben der kritischen Durchleuchtung der Gemütsvermögen des Menschen eine Differenzierung in Einzelvermögen zur Folge gehabt hat. Dementsprechend hat Kant auch eine scharf akzentuierte Trennung von Moral in der Bedeutung von Sittenlehre und Ästhetik in der Bedeutung von Schönheitslehre vorgenommen.
Sittliches Handeln beruht auf einem objektiven, allgemeingültigen Vernunftbegriff bzw. –gesetz; ästhetisches Beurteilen dagegen auf einer subjektiven Gefühlsverfassung. Das Schöne gefällt unmittelbar in der gefühlsbedingten, reflektierenden Anschauung. Das Wohlgefallen am Schönen[220] ist erstens ein uninteressiertes, zweitens ein begriffsloses und drittens ein zweckungebundenes, individuell strukturiertes Gefühl. Das Sittlich-Gute hingegen gefällt mittelbar, d. h. durch ein von der praktischen Vernunft aufgestelltes kategoriales Gesetz, anhand dessen dem sittlichen Gefühl kraft eines Begriffs sowohl das höchste Interesse wie auch ein höchster moralischer Zweck bezeigt ist. Ist dem ästhetischen Wohlgefallen ein beständiges Freisein von jeglicher Absichtsgerichtetheit in Bezug auf den Gegenstand notwendig, so liegt dem sittlichen Wohlgefallen im Gegensatz dazu hinsichtlich des Sittengesetztes, sobald dieses, wenn auch durch die Freiheit des Bewusstseins, durch die autonome Vernunft erst einmal aufgestellt ist, kein weiteres Urteil aus Freiheit mehr zugrunde, insofern nicht, als dem das Sittengesetz achtenden Individuum keine Alternative offengelassen ist, sich anders zu entscheiden bzw. zu handeln als im Sinne jenes Gesetzes.
Aufgrund der sowohl in der Beurteilung des Schönen als auch in der Autonomie[221] des Sittlichen enthaltenen Freiheitsäußerung konstatiert Kant neben allen von ihm vorher gegebenen Unterscheidungskriterien die besondere Relation des Symbolwerts der Schönheit für die Sittlichkeit. Wurde im anthropologischen Teil der Symbolwert der Schönheit mehr oder weniger eingeschränkt zum Zweck des beabsichtigten Nachweises eines Vernunftbegriffs der Schönheit bei Schiller, so erhält er jetzt seine rechtmäßige Zuordnung: den Bezug zur Sittlichkeit[222].
Der Aufweis der Relation der Schönheit zur Sittlichkeit zieht dennoch – und das muss gerade im Hinblick auf Schiller mit Nachdruck hervorgehoben werden – bei Kant keinesfalls eine gleichzeitige Aufhebung der prinzipiellen Differenzierungsmerkmale nach sich. Sowohl das Schöne als auch das Sittliche behalten ihre unbedingte Geschiedenheit voneinander aufgrund der ihnen wesensmäßig zugehörigen Ideen, da sie sonst ihre transzendentale Berechtigung, gewährleistet gerade durch ein je spezifisches Vermögen, aufgeben müssten. Eine Integration von Schönheit und Sittlichkeit zum Ästhetisch-Moralischen ist daher für Kant schlechterdings undenkbar, obgleich eine solche vermittels der Relation der Schönheit zur Sittlichkeit immanent vorkonstruiert ist.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 4.0.2.1. |
|
Der philosophisch-theoretische Ansatz Schillers
Schiller geht es in jedem Augenblick um die Einheit des Menschseins des Menschen, so auch und gerade in ästhetisch-moralischer Hinsicht. Die Relation der Schönheit zur Sittlichkeit hat Kant durch den Symbolwert der Schönheit zwar aufgedeckt, aber nichtsdestoweniger das Gesetz der einen von dem Gesetz der anderen streng unterschieden gehalten. Schiller ist in Entgegensetzung dazu bestrebt, einen Zusammenschluss beider zu erreichen, der sich zudem als ein notwendiger erweisen soll, um auf dem Boden einer ästhetisch-moralischen Geschlossenheit die Idee der Freiheit des Menschen ins Werk setzen zu können.
Dazu war zum einen nötig, die Schönheit mit einer apriorischen Begrifflichkeit zu belegen, welches durch ein spezifisch strukturiertes Erkenntnisprinzip ermöglicht wurde; zum anderen war es erforderlich, die Schönheit als notwendige Bedingung für die Menschheit nachzuweisen, welches durch ein dialogisches Wechselverhältnis zwischen dem Formprinzip der Schönheit und dem Wesensprinzip des Spieltriebs erreicht wurde. Beides zusammen, der Verstandesbegriff und der Vernunftbegriff der Schönheit als Objektivation des Erkenntnisprinzips einerseits, andererseits des Wesensprinzips geben Schiller die hinreichenden Bedingungen, der Schönheit nicht nur – wie bei Kant – symbolischen Wert bezüglich der Sittlichkeit und folglich der Freiheit zu bescheinigen, sondern sie darüber hinaus als das unveräußerliche Medium zur Freiheit zu postulieren, dass es »die Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit wandert«[223].
Der Rigorismus des Kantischen Sittengesetzes in seiner ausschließlichen Pflichterfüllung, ausgedrückt im kategorischen Imperativ der Sittlichkeit auf der einen Seite und die letztlich prinzipielle Geschiedenheit von Ästhetischem und Moralischem auf der anderen, vermittelt Schiller den theoretischen Impuls, seine ästhetische Erziehungsidee dagegenzustellen und zu behaupten, es gebe keinen anderen Weg, »den sinnlichen Menschen vernünftig zu machen, als daß man denselben zuvor ästhetisch macht«[224]. Denn es genügt in Schillers Augen nicht, lediglich ein abstraktes Vernunft- bzw. Sittengesetz zu deduzieren, sondern es ist zunächst angezeigt, den Menschen für das Sittengesetz vorzubereiten, ihn für dieses empfänglich zu machen, sodass das Gesetz nicht als Nötigung zur Pflichterfüllung erscheint, sondern aus eigener Einsicht und freiem Bewusstsein errichtet und letztendlich aus selbst gewählter Entscheidung einer Verwirklichung entgegengeführt werden kann. Dazu ist nun wiederum ein besonderes Prinzip notwendig, um erstens im Individuum eine eigentümliche Gestimmtheit hervorzurufen und zweitens darüber hinaus ihm ein bestimmtes Freiheitsgefühl zu vermitteln, welches die Bedingung bezüglich einer potentiellen Selbstverwirklichung des Menschen in ästhetisch-moralischer Hinsicht darstellt.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 4.0.2.2. |
|
Der historisch-konkrete Ansatz Schillers
Neben dem philosophisch-theoretischen Ansatz ist ein zweiter ebenso wichtiger zu berücksichtigen: der historisch-konkrete Ansatz Schillers. Dieser nimmt in den »Ästhetischen Briefen« unmissverständlich auf die politischen Zeitereignisse in Frankreich gegen Ende des 18. Jahrhunderts Bezug[225]. Es hieße jedoch zuviel behauptet, wollte man nun in dem Spielbegriff Schillers eine direkte Verbindung mit den Begebenheiten des revolutionären Frankreichs sehen. Wenn dennoch der historisch-konkrete Ansatz mit der Bedeutung des Spielbegriffs in Beziehung gebracht wird, so deshalb, weil zum einen die historische Komponente in den »Ästhetischen Briefen« nie ganz aus dem Blickfeld verschwindet und der konkrete Bezug ständig mitgedacht werden muss[226]; zum anderen weil sich dadurch der erkenntnispraktische Aspekt des Spielbegriffs erhellt und eine über den zeitgebundenen, geschichtlichen Rahmen hinausweisende Bedeutung erfährt.
Schiller hatte an die Französische Revolution anfangs hohe Erwartungen geknüpft[227], so etwa, dass der Staat der Natur und der dynamischen Kräfte, in dem der Mensch nur als Machtobjekt betrachtet wird, durch den Staat der freien Autonomie abgelöst werde, in dem der Mensch nicht nur nach Vernunftgesetzen regiert wird, sondern auch zugleich selbst regiert, d. h. in dem die gesetzgebende Institution seine eigene Vernunft ist und der aufgeklärte Vernunftstaat[228] Realität werden kann.
Schillers anfängliche Hoffnungen, durch die Proklamation der Menschenrechte und das Programm der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit genährt, wurden indessen durch den Revolutionsverlauf aufs höchste enttäuscht[229]. Es war in den Augen Schillers keineswegs die »wahre politische Freiheit«[230], die sich ihm in Frankreich darbot. Die Erkenntnis, die er daraus gewann, war, dass zwar »das Gebäude des Naturstaates[231] wankt, seine mürben Fundamente weichen, und eine physische Möglichkeit (...) gegeben« scheine, »das Gesetz auf den Thron zu stellen, den Menschen endlich als Selbstzweck zu ehren, und wahre Freiheit zur Grundlage der politischen Verbindung zu machen«, jedoch sei das vergebliche Hoffnung, denn die »moralische Möglichkeit fehlt, und der freigebige Augenblick findet ein unempfängliches Geschlecht«[232].
Aus diesem Grund schlägt Schiller einen anderen Weg ein, den der ästhetischen Erziehung[233], die den Menschen dahingehend zu bilden beabsichtigt, dass er in einem Zwischen- gleichsam Vermittlungsstadium sowohl die Totalität seines Wesens erfährt als auch seiner Bestimmung angesichts eines konkreten geschichtlichen Hintergrunds bewusst wird.
Dass Schiller sich durch die Wendung ins Ästhetische keineswegs von den historischen Gegebenheiten zurückzieht, verdeutlicht die Äußerung: »Ich möchte nicht gern in einem anderen Jahrhundert leben, und für ein anderes gearbeitet haben. Man ist eben so gut Zeitbürger, als man Staatsbürger ist«[234]; ferner die eher rhetorisch gemeinte Frage, ob es nicht »wenigstens außer der Zeit« sei, »sich nach einem Gesetzbuch für die ästhetische Welt umzusehen, da die Angelegenheiten der moralischen ein so viel näheres Interesse darbieten, und der philosophische Untersuchungsgeist durch die Zeitumstände so nachdrücklich aufgefordert wird, sich mit dem vollkommensten aller Kunstwerk, mit dem Bau einer wahren politischen Freiheit zu beschäftigen?«[235] Mit dieser Frage und der Bemerkung, dass man, »um jenes politische Problem in der Erfahrung zu lösen, durch das ästhetische den Weg nehmen muß, weil es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit wandert«[236], leitet Schiller unmittelbar zu seinem ästhetischen Thema über und stellt die Verbindung zwischen dem Politischen und dem Ästhetischen programmatisch her, womit er gleichzeitig unterstreicht, dass es ihm sehr wohl »ernst um die politische Freiheit«[237].
Die beiden aufgezeigten Ansätze Schillers – der philosophisch-theoreti-sche und der historisch-konkrete – sind keinesfalls als zwei voneinander unabhängige und nur parallel verlaufende Stränge misszuverstehen, die auf je getrennten Wegen zu der ästhetischen Erziehungsidee führen. Vielmehr stellen sie sich bei Schiller intentionell integriert dar und erst zusammengenommen geben sie die Begründung ab, weshalb es berechtigt erscheint, den dritten Aspekt des Spielbegriffs einen erkenntnispraktischen zu nennen.
In dem vorangegangenen Kapitel konnte gezeigt werden, dass es der Spielbegriff ist, der die Einheit des Menschen konstituiert und der Mensch in dem Schönheitsgegenstand eine symbolische Darstellung seiner eigenen Bestimmung, seiner Menschheitsidee gewinnt. Jetzt soll nachgewiesen werden, dass dem Spielbegriff auch die Bedeutung eines besonderen Erziehungsprinzips hinsichtlich einer ästhetisch-moralischen Einheit beigemessen werden kann und die Schönheit sich dabei als dessen eigentümlicher Erziehungsgegenstand herausstellt.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 4.1. |
|
Die Herleitung des Spielbegriffs aus erkenntnispraktischen Gründen
Analog der erkenntnistheoretischen Dualität von Sinnlichkeit und Verstand und dem anthropologischen Antagonismus von Zustand und Person, die jeweils zur Deduktion des Spielbegriffs mit einem je entsprechenden Bedeutungswert geführt haben, kontrastiert Schiller in der für ihn charakteristischen Weise der Antithetik auch die Formen des Staates und der in ihnen befindlichen Gesellschaftstypen. Um die Notwendigkeit einer ästhetischen Erziehung sowie die Bedeutung des erkenntnispraktischen Aspekts des Spielbegriffs kenntlich machen zu können, sollen im Folgenden die entscheidenden Merkmale aufgezeigt werden, die sich aus der Gegenüberstellung von Naturstaat bzw. »physischer Gesellschaft«[238] und Vernunftstaat bzw. »moralischer Gesellschaft«[239] ergeben.
Im Naturstaat ist der Mensch ein physischer, d. h. er ist »wirklich«[240]; im Vernunftstaat dagegen ist der Mensch ein sittlicher, und als solcher nennt ihn Schiller »problematisch«[241], weil eine Hinführung zur Sittlichkeit sich nur an einer Idee aus Vernunftgründen orientieren kann, d. h. in der Realität keinerlei direkte Vergleichsmöglichkeit besitzt und es folglich empirisch nicht beweisbar ist, ob die eigentliche Bestimmung des Menschen tatsächlich seine Sittlichkeit sein soll. Der »problematische«, sittlich nur mögliche und realiter nicht vorhandene Mensch kann demzufolge nicht zur Grundlage eines Vernunftstaates dienen[242]. In Anbetracht dessen ist mit der Überführung der physischen Gesellschaft in eine sittlich-moralische, also die Umwandlung des Naturstaates als ein »politischer Körper«, »der seine Einrichtung ursprünglich von Kräften, nicht von Gesetzen ableitet«[243], in einen Vernunftstaat, den die »freie Intelligenz« als Werk ihrer »freien Wahl«[244] leisten soll, ein erhebliches Risiko verbunden, welches, wird es nicht beachtet, für die Existenz des Menschen unausbleibliche Folgen hätte. Denn, so argumentiert Schiller, »hebt (...) die Vernunft den Naturstaat auf, wie sie notwendig muß, wenn sie den ihrigen an die Stelle setzen will«, so nimmt sie dem Menschen etwas, »das er wirklich besitzt, (...) und weist ihn dafür an etwas an, das er besitzen könnte und sollte; und hätte sie zuviel auf ihn gerechnet, so würde sie ihm für eine Menschheit, die ihm noch mangelt, und unbeschadet seiner Existenz mangeln kann, auch selbst die Mittel zur Tierheit entrissen haben, die doch die Bedingung seiner Menschheit ist. Ehe er Zeit gehabt hätte«, fährt Schiller fort, »sich mit seinem Willen an dem Gesetz fest zu halten, hätte sie unter seinen Füßen die Leiter der Natur weggezogen«[245].
Das Problem, das bei einer Umwandlung von der einen in die andere Staatsform sich zwangsläufig erhebt, ist also dies, »daß die physische Gesellschaft in der Zeit keinen Augenblick aufhören darf, indem die moralische in der Idee sich bildet«[246]. Denn ist die physische Gesellschaft bereits aufgelöst, bevor sich die moralische etabliert hat, so bedeutet das für die Existenz des Menschen, dass er sich nicht mehr dem Naturstaat, aber auch noch nicht dem Vernunftstaat als zugehörig betrachten kann und folglich ein gesellschaftlich konturloses Wesen darstellt[247]. Die Ursache dieses Problems liegt bekanntermaßen für Schiller in der sinnlich-vernünftigen Doppelnatur des Menschen selbst begründet und präsentiert gesellschaftlich in zwei Erscheinungsformen, die im Schillerschen Verständnis dem eigentlichen Menschsein zuwider sind. Die eine Erscheinungsform ist die des Wilden, in dem die Sinnesbedürfnis die Oberhand hat, nämlich »wenn seine Gefühle über seine Grundsätze herrschen«[248]; die andere ist die des Barbaren, in dem die Vernunft[249] die ausschließende Herrschaft innehat, d. h., »wenn seine Grundsätze seine Gefühle zerstören«[250]. Damit hat nach I. Kowatzki Schiller »die Problematik der menschlichen Selbstentfremdung gesehen und analysiert«[251], u. z. sowohl die des Einzelindividuums als auch die der Gesamtheit der Individuen, der Gesellschaft[252].
|
| 4.1.1. |
|
Die durch den Verlauf der Französischen Revolution hervorgerufene Desillusionierung Schillers bezüglich der Hoffnung auf Realisierbarkeit des Vernunftstaates[253] habe nach Ansicht G. Rohrmosers zur Folge gehabt, dass der »Glaube (...) an den abstrakten, von Kant übernommenen Begriff der Vernunft auf das tiefste erschüttert«[254] worden sei; er werde nun von Schiller als das erkannt, »was er immer schon war, eine Gestalt und Fixierung der objektiven Entfremdung im Subjekt«[255]. Das bedeutete für Schiller zugleich, dass der Vollzug der Aufklärung und damit die Verwirklichung des Vernunftstaates ohne Revolution, ja eigentlich nur ohne Revolution möglich[256] sei und er infolgedessen seine Philosophie des Ästhetischen als Vorbereitung und Ermöglichung der realen Freiheit auch im Politischen verstanden und ihr allein die Lösung des Problems zugetraut habe, das im Scheitern der Revolution ihm als ein gesellschaftlich und politisch unlösbares bewusst geworden sei[257]. Denn es hat sich für Schiller mit aller Deutlichkeit gezeigt, dass, um eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse herbeizuführen, es nicht genügt, die ökonomisch-sozialen Gegebenheiten zum Bewusstsein zu bringen – wie man Schillers Formulierung der »physischen Möglichkeiten« für diesen Zweck übersetzen könnte. Auch ist es nicht allein damit getan, ein zwar aus Vernunftgründen, so doch abstraktes Sittengesetz aufzustellen und dieses dem Menschen als einen Spiegel seiner Unsittlichkeit vorzuhalten, es aber dabei bewenden zu lassen. Es ist nach Schiller nichts damit erreicht, eine Revolution außerhalb des Menschen, in dessen objektiven Lebensbedingungen zu vollziehen, bevor nicht innerhalb des menschlichen Wesens, in seiner subjektiven Wesensstruktur eine Wandlung stattgefunden hat.
Die in der gesellschaftlichen Wirklichkeit sich darbietende Gespaltenheit von physischer Realität des Naturstaates und moralischer Ohnmacht des postulierten Vernunftstaates[258] setzt Schiller mit der Doppelnatur des Menschen gleich. Der Realitätsbezug bleibt zwar bestehen, wird aber von Schiller in idealistischer Weise in das Subjekt zurückgenommen insofern als der Naturnotwendigkeit, d. h. in diesem Zusammenhang der Zwang der politischen Gegebenheiten, die Vernunftfreiheit, nämlich die sittlich-autonome Kraft des Menschen entgegengesetzt wird und die Antinomien von Natur und Vernunft in der Wirklichkeit unaufgehoben und unvermittelt nebeneinander existent bleiben[259]. Auf der anderen Seite setzt Schiller die Einheit des Menschen mit sich selbst als notwendig voraus, wodurch eine Versöhnung im Wirklichkeitszusammenhang nur im Selbstbewusstsein des Subjekts möglich und letztlich erreicht werden kann[260].
|
| 4.1.2. |
|
Wenn also der Entfremdung des Menschen wirksam begegnet und der Forderung entsprochen werden soll, nämlich die Entartung der Gesellschaft[261] in einer auf Vernunftgesetzen gegründeten Staatsform zu beheben sowie, der zweiten Forderung gemäß, während des Bildungsprozesses die Fortdauer der Gesellschaft zu garantieren; dann muss »eine Stütze« aufgesucht werden, »die sie [die Gesellschaft; v. Verf.] von dem Naturstaate, den man auflösen will, unabhängig macht«[262]. Eine solche notwendige »Stütze« müsste nach Schiller folgende Eigenschaften aufweisen: erstens »von dem physischen Charakter die Willkür und von dem moralischen die Freiheit abzusondern«, zweitens »den ersten mit Gesetzen übereinstimmend, den letztern von Eindrücken abhängig zu machen«, drittens »jenen von der Materie etwas weiter zu entfernen, diesen ihr um etwas näher zu bringen«[263]. Diese Stütze wäre einem »dritten Charakter« vergleichbar, der sowohl mit dem »natürlichen Charakter des Menschen« als auch mit dem noch zu bildenden »sittlichen Charakter«[264] verwandt und demzufolge dazu befähigt ist, »von der Herrschaft bloßer Kräfte zu der Herrschaft der Gesetze einen Übergang« zu bahnen, u. z. »ohne den moralischen Charakter an seiner Entwicklung zu verhindern, vielmehr zu einem sinnlichen Pfad der unsichtbaren Sittlichkeit diente«[265].
Aufgrund der aufgezeigten Wesensstruktur des Menschen kann der »dritte Charakter« nicht in der Subjektivität der Beschaffenheit des Menschen auffindbar sein. Die Aufgabe muss demzufolge für Schiller lauten: im Individuum einen »dritten Charakter zu erzeugen[266] bzw. die Totalität seines Wesens[267] herauszubilden; denn die Wesenstotalität ist für Schiller die unabdingbare und notwendige Voraussetzung, wenn die disparate Struktur der Gesellschaft zur organischen Gestaltung, zur »Totalität des Charakters«[268] geführt werden soll, wenn sie »fähig und würdig sein soll, den Staat der Not mit dem Staat der Freiheit zu vertauschen«[269], um letztendlich das »vollkommenste aller Kunstwerke«, die »wahre politische Freiheit«[270] zu errichten[271].
|
| 4.1.3. |
|
Eine solche Bildung kann für Schiller nur eine ästhetische leisten. Denn das Ästhetische beziehe sich nicht auf ein einzelnes Gemütsvermögen, sondern »auf das Ganze unserer verschiedenen Kräfte (...), ohne für eine einzelne derselben ein bestimmtes Objekt zu sein«[272]; zudem wird allein Bereich des Ästhetischen den oben genannten Forderungen nach Existenzerhaltung und Wesenseinheit in besonderer Weise entsprochen.
Physische Beschaffenheit, d. h. Sinnlichkeit einerseits und vernünftige Beschaffenheit, d. h. Sittlichkeit andererseits gelten in Schillers dualistischer Auffassung erklärtermaßen als Gegenspieler und auseinanderstrebende Kräfte im Menschen. Da das Ästhetische bei Schiller als der Schnittpunkt aller Gemütsvermögen und –verfassungen begriffen werden muss, folglich alle Bewusstseinstätigkeiten gleichermaßen umfasst – also auch diejenigen, die im Schönheitsurteil und im Sittengesetz ihren Ausdruck finden –, wird verständlich, warum Schiller der ästhetischen Erziehung gegenüber einer sittlichen oder logischen oder gar moralischen die uneingeschränkte Priorität zuschreibt; denn die ästhetische Erziehung ist gerade nicht wie letztere auf ein Einzelgebiet fixiert, sondern hat »zur Absicht (...), das Ganze unsrer sinnlichen und geistigen Kräfte in möglichster Harmonie auszubilden«[273]. In der Sphäre des Ästhetischen[274] sind Sinnlichkeit und Vernunft »zugleich tätig«[275] und heben »eben deswegen (...) ihre bestimmende Gewalt gegenseitig«[276] auf. Der Mensch ist in diesem Zustand »von aller Bestimmung frei«[277], d. h. er wird weder seitens seiner physischen noch seitens seiner moralischen Beschaffenheit in irgendeiner Weise genötigt.
Wenngleich aufgrund der koordinativen Einbeziehung der beiden Extreme »Sinnlichkeit« und »Vernunft« als Sittlichkeitsvermögen im Ästhetischen das Individuum »frei und im höchsten Grade frei«[278] ist, so handelt es keineswegs »frei von Gesetzen«[279]. Schiller meint damit vorzüglich das Prinzip des Wechselverhältnisses der beiden Grundkräfte des Menschen, welches ja aus Vernunftgründen aufgestellt wurde und ihm deshalb der Wert eines Gesetzes beizumessen ist. Ferner müssen eben sowohl das moralische Gesetz wie auch dasjenige der Erkenntnis dazu gerechnet werden; denn sowohl das sittliche Empfinden als auch das logische Erkennen sind der Definition zufolge dem Ästhetischen wesensmäßig zugehörig und in ihm zu gleichen Teilen in Tätigkeit, sodass ihre jeweiligen Gesetzmäßigkeiten zur Ausübung kommen. Der alles entscheidende Unterschied jener, im Ästhetischen koordinierten Gesetze zu den einzelnen »der logischen Notwendigkeit beim Denken und (...) der moralischen Notwendigkeit beim Wollen«[280] besteht für Schiller gerade darin, dass die Gesetze, nach denen das Gemüt in der »ästhetische[n] Freiheit«[281] verfährt, »nicht vorgestellt werden, und weil sie keinen Widerstand finden, nicht als Nötigung erscheinen«[282].
Hier wird bereits die entscheidende Verwandtschaft des Spielbegriffs zum Ästhetischen sichtbar, die für dessen erkenntnispraktische Komponente bedeutsam ist: Auch im Spieltrieb besitzen ja die Naturgesetze des Stofftriebs und die Vernunftgesetze des Formtriebs keine nötigenden Wirkungen und werden, weil sie sich in einem Wechselverhältnis sowohl ergänzen als auch begrenzen, nicht als Zwang ausübende Gesetze empfunden bzw. vorgestellt.
|
| 4.1.4. |
|
Nach alldem liegt es nahe, den Begriff des »Ästhetischen« mit dem der »Totalität« in Beziehung zu setzen. Galt es doch für Schiller, zunächst die Totalität des Charakters herauszubilden, bevor die physische Gesellschaft in eine moralische und letztlich freie Gesellschaft sukzessive verwandelt werden kann. Wurde die Totalität als der organische Zusammenschluss von Sinnlichkeit und Vernunft, also auch Moralität, definiert und das Ästhetische als die Verknüpfungsinstanz jener beiden bestimmt, so kann folglich das Ästhetische als Ausdruck der »Totalität in unsrer Natur«[283] angesehen werden. Obgleich Schiller einschränkend sagt, dass der mittlere Zustand ästhetischer Freiheit »an sich selbst weder für unsere Einsichten, noch Gesinnungen etwas entscheidet, mithin unseren intellektuellen und moralischen Wert ganz und gar problematisch«[284], d. h. nur möglich sein lässt, gilt für ihn das Ästhetische als »die notwendige Bedingung, unter welcher allein wir zu einer Einsicht und zu einer Gesinnung gelangen können«[285]. Durch diese Bestimmung des Ästhetischen hat Schiller gleichzeitig auch dessen notwendigen Zusammenschluss mit dem Moralischen vollzogen und »seine ethische Forderung in der Formulierung des ästhetischen Zustandes ausgesprochen«[286]
|
| 4.1.5. |
|
Aus dem oben Gesagten und demjenigen, was bereits über den Spielbegriff dargelegt worden ist, sollte deutlich geworden sein, dass eine Affinität des Spielbegriffs zum Ästhetischen besteht. In beiden wirken antagonistische Zuständlichkeiten, physischer Zustand und vernünftiger Zustand, bzw. Kräfte, Stofftrieb und Formtrieb, zusammen und verlieren ihre nötigende Gewalt. Beide, sowohl der Spielbegriff als auch das Ästhetische, können mit dem Begriff der Totalität umschrieben werden: der Spielbegriff als Totalität des Wesens, insofern als in ihm die dualistische Wesenstruktur des Menschen vermittels des Prinzips der Wechselwirkung in eine dialogische gewandelt ist; der Begriff des Ästhetischen als Totalität des Charakters, insofern als im ästhetischen Zustand die Sinnlichkeit in gleicher Weise begehrt als die Sittlichkeit will und sich in wechselseitig vervollständigender Bewegung befinden. Erweiterung und Befreiung sind die hervorstechenden Kriterien, die das Ästhetische und den Spielbegriff in eigentümlicher Weise als verwandte Bereiche auszeichnen und letztendlich in Schillers Menschheitsidee ihre transzendentale Verankerung erfahren.
Freiheit impliziert für Schiller immer zugleich auch Moralität[287], umgekehrt ereignet sich Moralität nur in der Sphäre individueller Freiheit. Da im Ästhetischen eine besondere Form der Freiheit, nämlich die der ästhetischen Freiheit manifest wird, ist das Ästhetische notwendig mit dem Sittlichen zusammengeschlossen zu denken. Hieraus wird einsehbar, warum Schiller die These aufstellen konnte, dass es keinen anderen gebe, »den sinnlichen Menschen vernünftig zu machen, als daß man denselben zuvor ästhetisch macht«[288]. Das bedeutet hinsichtlich des Spielbegriffs, dass er diejenige Sphäre darstellt, in der das moralisch Rechte getan wird und die sinnlichen Leidenschaften des Menschen in ihren angemessenen Grenzen gehalten werden[289], wodurch schließlich die Freiheit selbst als ästhetisch verwirklichte Freiheit hervorspringt.
Ist also die erklärte Intention der ästhetischen Erziehung, die gespaltene Daseinsstruktur des Menschen zu einer versöhnten Einheitsverfassung zu bilden und hat sich der Spieltrieb als jenes Versöhnungsprinzip bzw. Einheitsprinzip bezüglich der Wesensbeschaffenheit des Menschen herausgestellt, so zeigt sich jetzt, dass dem Spielbegriff auch ein spezifisches Erziehungsprinzip im Rahmen der ästhetischen Erziehungsidee Schillers beigemessen werden kann.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 4.2. |
|
Die Bedeutung des Spielbegriffs als erkenntnispraktischer Begriff
Eingangs der Erörterung des Spielbegriffs hinsichtlich seiner erkenntnispraktischen Begründung wurde mit G. Rohrmoser darauf hingewiesen, dass als Folge der Ausartungen der Französischen Revolution auch Schillers Vertrauen in die abstrakte Vernunft eine tiefgreifende Erschütterung erfuhr und das wiederum eine Wandlung seines Vernunftverständnisses nach sich zog. Nachdem der Spielbegriff als Erziehungsprinzip ausgewiesen werden konnte, ist der Zeitpunkt gegeben, das näher zu verdeutlichen, weil dadurch nicht zuletzt die erkenntnispraktische Bedeutung des Spielbegriffs sich selbst konstituiert.
Kant hatte aus Vernunftgründen das Sittengesetz aufgestellt, dabei aber die Sinnlichkeit und mithin das Ästhetische mit Entschiedenheit ausgeklammert. Aufgrund dessen hatte er ungewollter Weise der Entfremdung des Subjekts Vorschub geleistet und die Vernunft, die als das oberste Vermögen begriffen wurde, gerade durch ihre einseitige Verabsolutierung zu einer abstrakten Vernunft erstarren lassen.
|
| 4.2.1. |
|
Im Spielbegriff Schillers ist das Vermögen der Vernunft notwendigerweise mit einbezogen und wird unmittelbar dem Sinnlichkeitsvermögen konfrontiert. Durch das Wechselverhältnis, in dem sich beide im Spielbetrieb zusammenfinden, büßt die Vernunft ebenso notwendig ihre rigorose Machtposition ein und wird gemäß der Forderung nach wechselseitiger Subordination in angemessenem Umfang der Sinnlichkeit partiell untergeordnet. Nicht, dass die Vernunft dadurch ihre Gesetzeskraft negieren müsste, sie verliert nur ihre Ausschließbarkeit, indem sie infolge der Zugehörigkeit zum Spielbegriff im Zusammenspiel mit der Sinnlichkeit selbst einer Erweiterung zugeführt wird. Desgleichen gilt für das Sittengesetz: nicht seine Gesetzlichkeit wird in Abrede gestellt, es wird lediglich seiner Abstraktheit und Rigidität entkleidet, indem es in Gemeinschaft mit den Naturgesetzen selbst an Lebendigkeit gewinnt.
Schillers Idee der Versöhnung, die im Spielbegriff zum Ausdruck kommt, ist »als die Erneuerung der konkreten Vernunft in der Gestalt und auf dem Boden der Subjektivität«[290] zu sehen und schließt »die Resignation vor der Ohnmacht der Vernunft in der Wirklichkeit und einer blinden, mit nötigendem Zwang ausgestatteten Notwendigkeit«[291] ein.
Auch noch in anderer Hinsicht stellt sich die Konkretisierung der Vernunft bei Schiller dar; nämlich dadurch, dass zum einen die ästhetische Erziehung auf die Seinstotalität des Individuums gerichtet und mit dem Be-griff des Spiels in der Bedeutung eines Erziehungsprinzips zu dem in ihr angelegten Ziel gekommen ist[292]; zum anderen dadurch, dass die Einheitsforderung selbst eine Forderung der Vernunft ist und das Individuum im Spieltrieb die Totalitätsforderung ästhetisch, d. h. sinnlich-vernünftig erfüllt, wird rückwirkend gleichermaßen auch die Totalität der Vernunft im Sinne des höchsten, alle übrigen umfassenden Gemütsvermögen ihrerseits auf einer umfassenderen Ebene[293] wieder hergestellt. Die Wandlung des Schillerschen Vernunftverständnisses besteht somit darin, dass es die abstrakte, unverfügbare und mithin entfremdende Vernunft zu einer konkreten Totalitätsvernunft[294] ästhetisch vervollständigt und im Spieltrieb verwirklicht hat. Umgekehrt heißt das aber auch, dass die so bezeichnete Vernunft nicht ohne den Spielbegriff gedacht werden kann; denn er ist es letztendlich, durch den sich die Vernunft als konkrete und totale erfährt. Hieraus wird gleichsam die Bedeutung des Spielbegriffs hinsichtlich seiner erkenntnispraktischen Komponente ersichtlich.
|
| 4.2.2. |
|
Nicht zuletzt hat jener Sachverhalt auch Auswirkungen auf die Rede von der »Einheit der Erkenntnis«. Angesichts der Erweiterung der Vernunft zur konkreten Totalitätsvernunft wird die vernunft-theoretische Esoterik der Einheitserkenntnis, die noch im anthropologischen Aspekt zu verzeichnen war, ebenfalls umfassender. Denn dadurch, dass im Spieltrieb die Bewusstseinstätigkeiten, d. h. die Tätigkeiten sowohl der Sinnlichkeit wie die der Vernunft bzw. Handlungen des Zustandes wie der Persönlichkeit in der Jetztzeit gemeinsam zur Ausübung gelangen und sich wechselseitig vervollständigen, wird die Erkenntniseinheit selbst konkretisiert, nämlich ästhetisch-tätig verwirklicht.
Infolge der Verankerung der Erziehungsidee im Spieltrieb und dessen damit zusammenhängender praktischen Orientierung, erfährt zudem die erkenntnispraktische Bedeutung desselben bezüglich der »Einheit der Erkenntnis« seine Evidenz. Wird nämlich diesem Genüge getan, ist gleichzeitig auch die Selbstentfremdung des Individuums kraft des Spieltriebs, also der bewussten Tätigkeit aller Gemütsvermögen aufgehoben und zur konkreten, zur erkenntnispraktischen Selbstbewusstheit, d. h. Selbstgeschlossenheit, Selbsteinheit erhöht. Die der Erkenntniseinheit vermittels der erkenntnispraktischen Dimension des Spielbegriffs bedeutet die Rückkehr zu seiner sinnlich-vernünftigen Natur auf höherer Ebene, welche durch Bewusstheit charakterisiert ist. Das besagt aber im Verständnis Schillers nichts weniger als einen Fortschritt; denn die wiedererlangte Natur, die bei dieser Rückkehr erreicht wird, ist qualitativ verschieden von jener, von der der Mensch ausgegangen ist, insofern als dieser »durch all die Einsicht und Mühe, die es uns gekostet hat dorthin zu gelangen, von ›Bewußtsein‹ durchdrungen, gesteigert und umgewandelt«[295] ist.
|
| 4.2.3. |
|
Jene konkrete Totalitätsvernunft sei es nach G. Rohrmoser, »die Schiller dem Prinzip der Französischen Revolution entgegenstellen wollte«[296]. Damit ist die erkenntnispraktische Seite des Doppelaspektes angesprochen, die aber trotz allem im Theoretischen verwurzelt bleibt und nur durch den historisch-konkreten Bezug sowie der daraus sich entwickelnden ästhetischen Erziehungsidee eine praktische Komponente gewinnt. Das, was unter besonderer Berücksichtigung der Erkenntnisseite gesagt worden ist, gilt eben sowohl für das Grundwort des zweiteiligen Aspekts, also für dessen praktischen Bedeutungsgehalt, weil dieser im Vorherigen nicht nur stets mitzudenken war, sondern selbst schon indirekt zum Vorschein kam.
Eine unvorbereitete und in ihrer Erscheinungsform disparate Menschheit bzw. Gesellschaft kann in Schillers Augen unmöglich unmittelbar zur Freiheit im Sinne einer wahren politischen Freiheit aufsteigen. Vielmehr muss sie allererst aus ihrer generisch selbstverschuldeten Entfremdung befreit und zur Wesenseinheit gebildet werden. Es ist also notwenig, dem Menschen eine Zustandsform zu geben, in der er seine sinnlich-ver-nünftige Natur gleichermaßen in Erfahrung bringen kann und seine Seinstotalität als verwirklicht vorstellig wird. Eine derartige Zuständlichkeit – wie bereits ausgeführt wurde – ist im ästhetischen Zustand ermöglicht. Dieser wiederum findet seinen Ausdruck im Spieltrieb, weil letzterer das Ganze des Menschen erfasst.
Aufgrund der Tatsache, dass sich der Spieltrieb als das eigentliche Erziehungsprinzip der ästhetischen Erziehung herausgestellt hat, ist er es bzw. seine Tätigkeitsform, nämlich der Spieltrieb selbst, der den Menschen in die Lage versetzt, das in ihm konkret erfahrene ästhetische Freiheitsgefühl in eine moralische Handlung zu überführen[297]. Erst der Spieltrieb, in dem der Mensch »ganz«[298] ist, in dem »sein niemals wechselndes Ich« den »in ihm wechselnden Stoff begleitet«[299] und »alle Wahrnehmungen zur Erfahrung, d. h. zur Einheit der Erkenntnis«[300], also auch und gerade den konkreten Wirklichkeitsbezug inbegriffen, zusammenfasst, ist der Mensch dazu berechtigt kraft seines zur konkreten Totalitätsvernunft gesteigerten Vernunftvermögens, »jede seiner Erscheinungsarten in der Zeit zum Gesetz für alle Zeiten zu machen«[301]. Erst wenn die Seinstotalität des Individuums durch den Spieltrieb, an dem alle Erscheinungsformen partizipieren und in ihm in Tätigkeit repräsentiert werden, gewährleistet ist, kann eine reale Einwirkung auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, kann »mit dem Bau einer wahren politischen Freiheit«[302] begonnen werden. Eine Veränderung der Gesellschaft basiert für Schiller einzig und allein auf einer vorausgegangenen Veränderung im Sinne einer in jeder Hinsicht erfolgten Erweiterung des Menschen; anders ausgedrückt: Eine Veränderung des Menschen ist keinesfalls Folge, sondern unabdingbare Voraussetzung jeder sozialen Revolution.
Der Schillersche Spielbegriff, so kann nun gefolgert werden, ist nicht allein nur theoretische Erkenntniseinheit in Bezug auf die Schönheit; er ist auch nicht nur Einheitserkenntnis hinsichtlich der Wesensstruktur des Menschen; sondern er stellt in gleichem Maße auch eine konkrete Erkenntniseinheit bezüglich der möglichen Verwirklichung einer ästhetischen Freiheit dar und besitzt erkenntnispraktische Relevanz im Hinblick auf die reale Behebung der Selbstentfremdung des Menschen.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 4.3. |
|
Der Erziehungsgegenstand des Spieltriebs
Wie schon beim anthropologischen Aspekt, so ist auch die erkenntnispraktische Bedeutung des Spielbegriffs erst durch dessen Gegenstand, die Schönheit, endgültig erklärbar.
Doch muss zuvor klar gesagt werden, dass die Schönheit, wie Schiller sie verstanden wissen will, keine eigentliche Erziehungsfunktion innehat, d. h. die Schönheit darf selbst nicht als didaktische Realisierung der Erziehungsidee oder des Erziehungsprinzips ausgelegt werden. Vielmehr wahrt die Schönheit gemäß ihrer Definition als »Freiheit in der Erscheinung« ihre eigene, uneingeschränkte Autonomie gegenüber jeglicher gerichteten Zweckanwendung, nicht zuletzt auch gegenüber der Bildung des Menschen zu einem ästhetischen bzw. sittlichen. Die Schönheit ist als solche keine dem Menschen verfügbare Größe in dem Sinne, dass er sie nach seinem Dafürhalten funktional einsetzen kann[303].
Die Bestimmung der Schönheit, die »in der absoluten Einschließung aller [Realitäten]«[304] besteht und sie somit der »einzig mögliche Ausdruck der Freiheit in der Erscheinung«[305] ist, ist es wiederum, die dazu Veranlassung gibt, der Schönheit aufgrund ihrer Struktur dennoch – oder gerade deshalb – einen erkenntnispraktischen Erziehungswert beizumessen und unter Berücksichtigung der wechselseitigen Grund-Folge-Relation[306] zwischen ihr und dem Spieltrieb die Schönheit als Erziehungsgegenstand des Spieltriebs ausweisen zu können.
|
| 4.3.1. |
|
Dass die Schönheit in höchstem Maße autonom ist, zugleich aber im selben Grad zum Erziehungswert prädestiniert erscheint, zeigen folgende Äußerungen Schillers:
Er nennt die Schönheit »unsre zweite Schöpferin (...). Denn ob sie uns gleich die Menschheit möglich macht, und es im übrigen unserm freien Willen anheim stellt, in wie weit wir sie wirklich machen wollen, so hat sie dieses ja mit unsrer ursprünglichen Schöpferin, der Natur, gemein, die uns gleichfalls nichts weiter, als das Vermögen zur Menschheit erteilte, den Gebrauch derselben aber auf unsre eigene Willensbestimmung ankommen läßt.«[307]. Und eine weitere Stelle, die jene angeführte unterstreicht, besagt, dass die Schönheit sich zwar »in kein Geschäft weder des Denkens noch des Entschließens mische«[308], aber nichtsdestoweniger »zu beiden (...) das Vermögen erteile«[309]. Obgleich Schiller mit dem angesprochenen Vermögen den ästhetischen Zustand meint, ist es aus angegebenen Gründen erlaubt, diesen durch den Spielbegriff zu ersetzen[310].
|
| 4.3.2. |
|
Gemäß Schiller ist es allein die Schönheit, durch welche »der sinnliche Mensch zur Form und zum Denken geleitet« und »der geistige Mensch zur Materie zurückgeführt, und der Sinnenwelt wiedergegeben«[311] werde. Nur durch die Schönheit bzw. der in ihr anschaulich werdenden »ästhetischen Einheit« sei »eine wirkliche Vereinigung und Auswechslung der Materie und der Form, und des Leidens mit der Tätigkeit«[312] gewährleistet. Und »Tätigkeit« heißt im positiven Sinn – und dieser ist von Schiller mit der Schönheit intendiert – immer zugleich moralisches, sittliches Handeln. Dadurch, dass die Schönheit sich dem Menschen als sinnliche Erscheinung Freiheit, somit als symbolische, »vollständige Anschauung seiner ausgeführten Bestimmung«[313] präsentiert, übt sie eine absichtliche Wirkung auf die Gegensätzlichkeiten von Empfindung und Denken aus und ruft eine Gemeinschaft beider im Menschen hervor. Das bedeutet, dass erst durch die Schönheit »die Vereinbarkeit beider Naturen, die Ausführbarkeit des Unendlichen in der Endlichkeit, mithin die Möglichkeit der erhabensten Menschheit«[314] garantiert ist.
Aufgrund dessen, dass die Schönheit selbst diejenige Einheit und Freiheit in der Erscheinung, d. h. die »Konsummation seiner [des Menschen; v. Verf.] Menschheit«[315] darstellt, nach der der Mensch, um sich zu verwirklichen, aufgefordert ist zu streben, erscheint es als gerechtfertigt, der Schönheit einen als ursächlich zu nennenden Erziehungswert beizulegen, jedoch zunächst lediglich in erkenntnispraktischer Hinsicht.
|
| 4.3.3. |
|
Schillers Deduktion des Spieltriebs aus den Konstituenten Sinnlichkeit und Vernunft bzw. Zustand und Persönlichkeit ist – so wurde gesagt – in der strukturellen Erweiterung der abstrakten, nur formalen Vernunft zur konkreten, praktischen Totalitätsvernunft, die selbst wiederum im Spieltrieb ihre Konkretheit erfährt, begründet. Desgleichen gilt notwendigerweise bezüglich des Schönheitsbegriffs; denn die Schönheit als der erklärte Gegenstand des Spieltriebs muss ebenfalls als das besondere Resultat der praktischen Totalitätsvernunft begriffen werden[316] und gewinnt erst in der bewussten Tätigkeit des Spieltriebs die erforderliche Konkretisierung.
Berücksichtigt man des Weiteren Schillers Rede von der »Erziehung zum Geschmack und zur Schönheit«[317] – wobei in diesem Zusammenhang lediglich diejenige zur Schönheit von Belang ist –, so wird der erkenntnis-praktische Erziehungswert der Schönheit evident. Denn wenn bei Schiller zum Vergleich »Erziehung zur Sittlichkeit« besagt, dass der noch nicht moralisch zu nennende Mensch dahin zu erziehen ist, moralisch zu werden und sittlich zu handeln, dies jedoch nur erreicht werden kann, wenn der Mensch »zuvor ästhetisch«[318] gemacht worden ist, und das heißt, zugleich »ganz«[319] ist; ferner die Schönheit das Moralische in sich begreift und im Spieltrieb der Mensch in einem Wechselspiel mit der Schönheit sich bekundet, so ist hieraus Folgendes zu schließen: Wenn Schiller von der Erziehung zur Schönheit spricht, so bedeutet das, dass der sich selbst entfremdete Mensch wieder zur Einheit, zur Ganzheit zu bilden ist und die Schönheit als sein eigenes Wesenselement begreifen lernt, um letztlich sich selbst als »Freiheit in der Erscheinung« zu verwirklichen.
Da dies aber nirgendwo anders möglich ist als in der Konkretheit des Spieltriebs, weil der Mensch nur dort mit der Schönheit spielt, d. h. durch das Spiel die Schönheit verwirklicht wird und das Erziehungsziel die Heranbildung des Spieltriebs, folglich die Schönheit ist, so ist der Erziehungsgegenstand des Spielbegriffs kein anderer als die Schönheit. Die konkrete Totalitätsvernunft, die »aus transcendentalen Gründen«[320] den Spieltrieb aufgestellt hat, hat somit gleichzeitig den Schönheitsbegriff notwendigerweise involviert und im ersteren als dessen eigentümlichen Erziehungsgegenstand konkretisiert, wodurch letztlich auch der erkenntnispraktische Erziehungswert der Schönheit deutlich hervortritt[321]. Denn Schönheit ist für Schiller die im Objekt vollzogene Einswerdung von Vernunftideen und materialen Belangen[322].
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 5. |
|
Die »Einheit der Erkenntnis« als die Bedeutung des Spielbegriffs (Zusammenfassung)
Die Erörterungen der Einzelaspekte haben zu einer je spezifischen Bedeutungsperspektive des Spielbegriffs geführt und diesen als ein je besonderes Prinzip bezüglich des Individuums ausgewiesen. Dabei kann rückblickend festgestellt werden, dass bei allen einzelnen Prinzipien, bei dem Erkenntnisprinzip ebenso wie bei dem Wesensprinzip und bei dem Erziehungsprinzip, die »Einheit der Erkenntnis« als das allen gemeinsame Moment sich abhebt.
So war es im erkenntnistheoretischen Aspekt die Einheit von Sinneswahrnehmung und Verstandestätigkeit, die im Spielbegriff vollzogen wurde und zur Erkenntniseinheit hinsichtlich der »lebenden Gestalt« führte, welche ihrerseits das begriffliche Kriterium der Schönheit ausmachte. Im anthropologischen Aspekt konstituierte sich aus Vernunftgründen die »Einheit der Erkenntnis« im Spielbegriff als das Gesetz der Wechselwirkung, welches die Erfahrung der Wesenseinheit des Menschen aus »Person« und »Zustand« ermöglichte. Der erkenntnispraktische Aspekt schließlich zeigte den Spielbegriff als »Einheit der Erkenntnis« durch den Vollzug der Erweiterung des Vernunftvermögens zur Totalitätsvernunft, wodurch das Ästhetische mit dem Moralischen im Bewusstsein zur konkretisierten Seinstotalität verknüpft wurde und als Folge dessen sich die »ästhetische Freiheit« des Individuums einstellte.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| 5.1. |
|
Die Bedeutung der »Einheit der Erkenntnis« des Spielbegriffs als Tätigkeit der Bewusstseinseinheit
Spiel ist bei Schiller aufgrund der in ihm vollzogenen Integration der Gemütsvermögen wesentlich bestimmt als Bewusstseinstätigkeit; denn im Spiel treten Reflexionsvermögen und Empfindungsvermögen in ein tätiges Verhältnis. Dabei steht die Tätigkeit einzig unter dem Gesetz der Wechselwirkung, welches der Totalitätsvernunft entstammt und aufgrund dessen ein Gesetz der Freiheit ist. Die Tätigkeit bekundet sich demzufolge als ein freier Dialog sowohl zwischen jenen Vermögen im Individuum als auch zwischen diesem und der äußeren Erscheinungswelt. Somit umfasst die Tätigkeit des Spiels gleichermaßen die subjektive Seinsverfassung wie die objektive Daseinsbeschaffenheit und stellt die zur »Einheit der Erkenntnis« dialogisch frei verfasste Tätigkeit der Bewusstseinseinheit dar.
Dieses Kriterium des Spiels ist in besonderer Weise durch dessen Gegenstand, der Schönheit, gewährleistet, mithin potenziert; selbst wenn die Schönheit keine materielle Gegenständlichkeit besitzt, sondern in der immateriellen Sphäre der Erscheinung anwesend ist und sich erst im Bewusstsein des Individuums reflexiv zur Erscheinungseinheit konstituiert. Die Schönheit ist also wesentlich »ästhetischer Schein«[323]. Um den ästhetischen Schein als solchen erfassen bzw. erkennen zu können, muss der Spieltrieb sich entfaltet haben. D. h., dass nur der im Spiel begriffene Mensch dazu befähigt ist, den Schein weder mit der Wirklichkeit noch mit der Wahrheit der Dinge zu verwechseln und ihn »als etwas Selbständiges«[324] zu betrachten, mithin anzuerkennen. Die Tätigkeit des Spiels offenbart sich also dadurch, dass das Bewusstsein den Schein von der Wirklichkeit unterscheidet und ihn infolgedessen von dieser absondert. Durch jene Unterscheidung tritt der Mensch in eine notwenige Distanz zur Materie[325]; und indem er sich gleichsam als Mensch von ihr abhebt, wahrt er die Möglichkeit seines Menschseins. Denn, so sagt Schiller, »die Realität der Dinge ist ihr (der Dinge) Werk; der Schein der Dinge ist des Menschen Werk, und ein Gemüt, das sich am Schein weidet, ergötzt sich schon an dem, was es ist«[326].
Der ästhetische Schein ist folglich die Bewusstseinsleistung des ästhetisch freien, sich seines Menschseins bewussten Individuums[327]. Gleichwohl ist eine derartige Leistung wiederum nur dann ermöglicht, wenn die Einheit des Bewusstseins, also die der Erkenntnis gegeben ist, und dies ist allein im Spiel garantiert.
Das Wesen des Menschen kommt in der Schönheit als der »Freiheit in der Erscheinung« zur Darstellung; das Wesen der Schönheit offenbart sich im »ästhetischen Schein« als der Ausdruck der Freiheit des Bewusstseins; das Wesen des ästhetischen Scheins gründet schließlich in der Seinstotalität des Menschen, die sich wiederum im Spiel als Tätigkeit der Bewusstseinseinheit bekundet.
Schönheit, Schein und Spiel bilden einen in sich geschlossenen, autonomen Kreis, in dem der Mensch sein Menschsein heautonom in Erfahrung, und das heißt nichts anderes als zur »Einheit der Erkenntnis« bringt. Denn in jenem Kreis und insbesondere im Begriff des Spiels ist die Sinneserfahrung zusammen mit der Erfahrungserkenntis zur Erfahrungseinheit vervollständigt.
Wenngleich die Wirklichkeit dadurch zwar ausgeschlossen ist[328], so ist der Ausschluss in einer besonderen Weise geschehen. Innerhalb jener Sphäre der Schönheit, des Scheins und des Spiels herrscht der Mensch aufgrund seiner erlangten ästhetischen Freiheit nach eigenen Gesetzen. Die Wirklichkeit als determinierendes Moment ist dadurch veräußert, dass gerade durch die Unterscheidung der Wirklichkeit von dem Schein aufgrund der Bewusstseinstätigkeit des allein auf die Schönheit, mithin auf den Schein konzentrierten Spiels zugleich auch die Wirklichkeit als solche im Bewusstsein notwendigerweise anwesend ist. Denn eine Abgrenzung des einen Bereichs von dem anderen ist nur dann möglich, wenn zuvor beide Bereiche in ihrer Unterschiedlichkeit erkannt und ihre Differenzen aufgezeigt worden sind. Folglich ist die Ausklammerung der Wirklichkeit aus dem Bereich der Schönheit und des Scheins durch eine, auch jenen Bereich umfassende Erkenntnis- bzw. Bewusstseinseinheit notwendig bedingt. Eine solche Einheit ist einzig im Begriff des Spiels strukturiert und ist selbst wiederum nur in der Tätigkeit des Spiels als Bewusstseinsoperation konkretisiert. D. h., gerade durch das Spiel mit der Schönheit ist angezeigt, dass eine Unterscheidung zwischen Schein und Wirklichkeit stattgefunden hat, denn sonst wäre jene Tätigkeit nicht mehr Spiel zu nennen, und die ästhetische Einheit nicht mehr gegeben.
|
| 5.1.1. |
|
Indem »der Mensch (...) mit der Schönheit nur spielen [soll]«[329], maßt er sich in keinem Augenblick an, die Wahrheitserkenntnis innoviert zu haben, sondern ist sich über den unendlichen Abstand zur absoluten Wahrheit bewusst und bewahrt gerade dadurch im Ästhetischen seine Freiheit als endliches Wesen. Indem »er (...) nur mit der Schönheit spielen [soll]«[330], wird ihm sein Menschsein bewusst, nimmt er seine Seinstotalität in den Blick, sodass er sich als Sinnen- und Vernunftwesen gleichermaßen erfährt und zur Wesenseinheit versöhnt. Im Begriff des Spiels ist die geforderte Einheit im Sinne einer dialogischen Bewegung der Bewusstseinshandlungen vollzogen, d. h. der konkrete Vollzug der dialogisch strukturierten Wesensverfassung von Subjektivität und Objektivität manifestiert. Beide Bereiche durchdringen sich wechselseitig in der ästhetischen Handlung des Bewusstseins, wodurch die Menschheitsidee in der Erscheinung versinnlicht wie umgekehrt die Erscheinung der Menschheitsidee in der Einheit der Spieltätigkeit verwirklicht wird.
Aufgrund dessen kann das Spiel bei Schiller als die höchste Bewusstseinsstufe für den Menschen als endliches Wesen interpretiert werden, weil die »Einheit der Erkenntnis« im Augenblick des Spiels, in dem die Zeit in der Zeit als aufgehoben vorgestellt wird, die größtmögliche Ausdehnung und Erweiterung erreicht hat.
|
| 5.1.2. |
|
Hieraus erklärt sich letztlich auch Schillers Grundthese, dass »es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit wandert«[331]. dabei ist die Schönheit wohl weniger im Sinne eines bloßen Durchgangsmediums zu verstehen, welches seine Relevanz mehr oder weniger erfüllt hat, sobald die Freiheit erreicht sein wird. Vielmehr legt die Präposition »durch« den Gedanken nahe, dass Schiller nicht zuletzt auch auf den Begriff des Spiels reflektiert. Denn die Schönheit ist als solche nur eine Erscheinungs- und keine Handlungsform der Freiheit und kann deshalb diese nicht unmittelbar als eine durch Tätigkeit zu verwirklichende nach sich ziehen.
Es ist die Tätigkeit des Spiels, welche in der präpositionalen Beziehung zur Freiheit mitgedacht werden muss. Denn in dem Spiel mit der Schönheit wird diese als Freiheit in der Erscheinung kraft des im Spiel tätigen Bewusstseins konkret als Freiheit erfahren. Und das besagt, dass der mit der Schönheit spielende Mensch zum ersten Mal die Freiheit bewusst in Erfahrung bringt, indem er sich selbst in ästhetischer Freiheit erkennt[332]. Durch die Einbeziehung des Spiels wird verständlich, warum es die Schönheit ist, die es dem Menschen ermöglicht, die Freiheit zu verwirklichen; denn die Freiheit kann nicht ohne die Schönheit, ebenso wenig ohne das bewusste Spiel mit dieser weder in Erfahrung noch zur Verwirklichung gebracht werden[333].
|
| 5.1.3. |
|
Nicht zuletzt erhält Schillers Rede von der »wahren politischen Freiheit«[334] durch den Begriff des Spiels eine mögliche Erklärung, wenngleich Schiller selbst in den »Ästhetischen Briefen« keine unmittelbar eindeutigen Aussagen dazu macht. Betrachtet man nämlich das Ganze der »Ästhetischen Briefe«, in denen es ja vornehmlich um die Schönheit geht und der Begriff des Spiels mit dieser in wechselseitiger Kohärenz steht, zugleich aber die »Sache der Schönheit« in einen geschichtlichen Rahmen gestellt ist, so kann auch der Spielbegriff mit der »wahren politischen Freiheit« in Beziehung gesetzt werden.
Spiel zeigte sich als eine besondere Form der Tätigkeit, nämlich als diejenige der Bewusstseinseinheit, welches gleichzeitig eine Erweiterung des Bewusstseins selbst bedeutet. Infolgedessen ist im Spiel sowohl die theoretische Vernunft als auch die praktische Vernunft als wesentliches Ingrediens anwesend und zur umfassenden Totalitätsvernunft gesteigert. Das bedeutet, dass dem Begriff des Spiels die praktische, d. h. die moralische Dimension als apriori zugehörig aufgefasst werden muss. Es wäre allerdings falsch, der Tätigkeit des Spiels bei Schiller moralische Zwecke unterschieben zu wollen; denn – so wurde gesagt – der Unterschied zwischen ästhetischer Tätigkeit und moralischer Handlung besteht darin, dass die erstere eine im Bewusstsein sich abspielende Tätigkeit ist, die wesensmäßig zweckungebunden und absichtsfrei ist, während die moralische Handlung eine nach außen gerichtete ist, die die Erfüllung des Sittengesetzes zum Zweck hat.
Dennoch wird durch die ästhetische Erziehungsidee Schillers und die Art und Weise der ästhetischen Freiheit ersichtlich, dass dem Spiel nichtsdestoweniger die Implikationen des sittlichen Handelns, des Sittengesetzes notwenig inhärent sind und der spielende Mensch das moralisch Rechte tut, ohne zugleich unter der Ernsthaftigkeit der moralischen Pflichterfüllung die Absicht verfolgt, das Gute wollen zu müssen. Für Schiller ist demnach – so könnte gedeutet werden – die wahre politische Freiheit durch den Vollzug der Totalitätsvernunft, konkretisiert in dem Spiel mit der Schönheit, als ästhetische Freiheit bereits verwirklicht.
Das Spiel als Einheit der Tätigkeit des Bewusstseins ist der einzige Garant, dass der Mensch als »zoon politikon«[335] zugleich auch dazu befähigt ist, an die Stelle der ungezügelten Macht der Leidenschaften wie der unbeugsamen Herrschaft des Sittengesetzes die wahre politische Freiheit in der Gemeinschaft zu setzen.
Das beinhaltet aber mithin, dass das Spiel selbst die wahre politische Freiheit repräsentierte und diese, da es dem Spiel gemäß seiner Bestimmung zusammen mit der Schönheit bzw. dem Schein untersagt ist, sich in den spielfremden Bereich der Wirklichkeit einzumischen, in der Realität gar nicht erst zur Verwirklichung gelangte. Die Lösung dieses Problems ist, wie bereits erwähnt, von Schiller nicht explizit formuliert, aber in Anbetracht des Gesagten[336] steht zu vermuten, dass sie folgendes Aussehen haben könnte: In der Sphäre des Spiels ist der Mensch in voller Bedeutung des Wortes »Mensch«, weil sein Selbst- und Weltbewusstsein dialogisch zur »Einheit der Erkenntnis« erweitert, er also »ganz« ist, d. h. seine sinnlich-vernünftige Seinsbeschaffenheit soweit zur Versöhnung gebildet und er sich seiner Bestimmung, seiner Menschheitsidee bewusst ist, sodass er durch jene im Spiel gewonnene Einheit in die Lage versetzt sein wird, beim Heraustreten aus der Idealität des Spielkreises in die Realität jene Erfahrungseinheit zur Anwendung zu bringen, ohne dabei Realität und Idealität zu vermischen und fälschlicherweise zu identifizieren. Der Spielbegriff ist somit, wenn nicht selbst die ausgeführte politische Freiheit, so doch der entscheidende Handlungsbegriff bezüglich ihrer Verwirklichung im Sinne einer nicht repressiven, sondern freien, auf dem Gesetz des Spiels, nämlich der Einheit der Erfahrung gegründeten Kultur[337].
|
| 5.1.4. |
|
Im Begriff des Spiels, so kann abschließend gesagt werden, manifestiert sich der Versuch Schillers, anhand ästhetischer Deutungsmuster der Wirklichkeit die ausgeschlossene Dimension übersinnlicher Realität, d. h. die Idee der Freiheit zu bestimmen, um die gezogene Grenze der Erfahrbarkeit von Realität zu überschreiten und somit letztlich die verlorene Einheit der Erfahrung, und das heißt die Bewusstseinseinheit in der Bedeutung der »Einheit der Erkenntnis«, in der Sphäre des ästhetisch freien Spiels mit der Schönheit als der »Freiheit in der Erscheinung« neu zu konstituieren[338].
Im Begriff des Spiels ist der Mensch wie durch ein Brennglas sowohl als Zweck wie auch als Mittel, als Ziel wie zugleich als Ausgangspunkt zur Einheit fokussiert. Spiel und Schönheit stellen sich bei Schiller als Spontaneität und Projektion, als Tätigkeit und Erscheinungsform des freien Menschseins dar. In der Tätigkeit des Spiels mit der Schönheit bekundet sich nicht nur der unmittelbare Bezug der dialogisch versöhnten Wesensverfassung des Menschen zur Freiheit, sondern jene Tätigkeit ist selbst der Vollzug dieser Relation, ausgedrückt als die ästhetische Freiheit des Spiels.
[zum Inhaltsverzeichnis]
|
| [1] |
|
Als Textgrundlage wurden die Ausgaben: Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen. Briefe an den Augustenburger, Ankündigung der »Horen« und letzte, verbesserte Fassung. Hrsg. v. Wolfhart Henckmann, München 1967; sowie: Schillers sämtliche Schriften. Historisch-kritische Ausgabe. Hrsg. v. Karl Goedecke u. a., Stuttgart 1867-1876 benutzt.
|
| [2] |
|
Die eigentliche Erörterung des Spielbegriffs wird in den Briefen 11 – 15 geführt.
|
| [3] |
|
Als Beleg für die Schwierigkeit, die es macht, die vielfältig verwobenen Aussagen und Gedankengänge Schillers in den »Ästhetischen Briefen« darzulegen, sei folgende Stelle aus einem Brief W. v. Humboldts vom 15.08.1795 angeführt, in dem er berichtet: »Jemand sagte mir (...) er verstehe sie nicht (...). Bei ihnen empfinge man sehr leicht jeden Satz und glaube alles gleich zu fassen; aber frage man sich hernach, was man gelesen habe, so wisse man es nicht auszudrücken (...)« (zit. nach F. Böversen, S.451).
|
| [4] |
|
vgl. »Ästh. Br.«, S.78
|
| [5] |
|
Da diese Arbeit sich nicht in irgendeiner Weise als eine Erörterung der Forschung zu Schillers Spielbegriff versteht, sei aus diesem Grund auf die Arbeit von I. Kowatzki verwiesen, die in einem gesonderten Kapitel den Stand der Forschung (bis 1969) »im Hinblick auf die Bedeutung von ›Spiel‹ und ›Spieltrieb‹« in einem größeren Überblick skizziert.
|
| [6] |
|
So sind beispielsweise folgende Arbeiten zu nennen, die sich explizit und aus dem Titel bereits entnehmbar mit dem Spielbegriff Schillers befassen: I. Kowatzki, Der Begriff des Spiels als ästhetisches Phänomen. Von Schiller bis Benn, 1973; des Weiteren Winfried Sdun, Zum Begriff des Spiels bei Kant und Schiller, 1966; und schließlich Wolfdietrich Rasch, Schein, Spiel und Kunst in der Anschauung Schillers, 1960. Die ersten beiden genannten Arbeiten sind auch im Folgenden berücksichtigt worden, wohingegen die letzte keine Verwendung erfuhr, da sie nur allgemeine Aussagen enthält, die keine tieferen Einsichten zum Spielbegriff vermittelt und die zudem in anderen benutzten Arbeiten enthalten sind. Mit der Aufzählung jener drei Arbeiten ist weder ein Vollständigkeitsanspruch verbunden noch ist daraus der Schluss zu ziehen, dass andere Untersuchungen nicht ebenfalls Wichtiges über den Spielbegriff enthalten.
Ein Werk soll in diesem Zusammenhang noch erwähnt werden, u. z. die Untersuchung I. Heidemanns, Der Begriff des Spieles, 1968. In einem 1958 gehaltenen Vortrag über philosophische Theorien des Spiels hat dieselbe Autorin die Geschichte der Spieltheorien im engeren Sinn mit Schillers »Ästhetischen Briefen« beginnen lassen und hebt hervor, »dass in den späteren Spieltheorien eine solche Systematik, wie Schiller sie zugrunde gelegt hat, nicht mehr erreicht« (S.316) werde. Umso verwunderlicher ist es, dass in der genannten, bei weitem umfangreicheren Arbeit eine jener Äußerung entsprechende detaillierte Ausführung über den Schillerschen Spielbegriff gänzlich fehlt und dieser nur mit einigen verstreuten Bemerkungen abgetan wird.
Dagegen wird dem Spielbegriff Kantischer Prägung ein eigenes ausführliches Kapitel gewidmet. Wenngleich dies zweifellos berechtigt ist, so steht es dennoch in keinem rechten Verhältnis zu der Bedeutung des Spielbegriffs bei Schiller und zum »ästhetischen Weltbild in der Philosophie der Gegenwart« – wie der Untertitel der Arbeit I. Heidemanns heißt.
|
| [7] |
|
vgl. dazu Julia Wernly, die in ihren »Prolegomena zu einem Lexikon der ästhetisch-ethischen Terminologie Friedrich Schillers« eine differenzierte Aufschlüsselung der Verwertung des Spiels für das Gesamtwerk Schillers vornimmt und drei große Gruppen unterscheidet: 1. Spiel im Sinne von Bewegung, 2. Spiel im Sinne von Geschäft, Angelegenheit und 3. Spiel in der Bedeutung von Tätigkeit, wobei die erste und die zweite Gruppe wiederum unterteilt werden.
|
| [8] |
|
In ähnlicher Weise argumentiert W. Sdun und sieht die eigentliche Theorie des Spiels in den Briefen 11 – 16 durchgeführt.
|
| [9] |
|
»Ästh. Br.«, S.77
|
| [10] |
|
»KdU«, S.296
|
| [11] |
|
So sagt etwa W. Sdun, Schiller habe an dem »freien Spiel« Kants nicht vorbeisehen können und, dass »von hier aus Schillers Spielbegriff verständlich« (S.503) werde. Auch W. Janke sieht in Schillers »Schlusssatz« über die Ganzheit des Menschen im Spiel mit der Schönheit die vervollständigende Fortführung der vorläufigen Bemerkung Kants, Schönheit sei nur da, wo der Mensch ganz (im freien Spiel aller seiner Erkenntniskräfte) ist (S.436/37). Für »müßig« (S.46) dagegen hält es W. Böhm, über die Anlehnung des Wortes Spiel an Kants Wendung vom »freien Spiel« sich näher auszulassen und erwähnt es nur im Vorbeigehen.
|
| [12] |
|
I. Heidemann, Philosophische Theorien des Spiels, S.316
|
| [13] |
|
Dieses haben Vertreter des Neukantianismus in ausführlicher Weise geleistet, wie etwa – um nur einige zu nennen – B. Bauch, W. Windelband, E. Cassirer.
|
| [14] |
|
»KdU«, S.201
|
| [15] |
|
»KdU«, S.201
|
| [16] |
|
»KdU«, S.201
|
| [17] |
|
Wobei Erkennbarkeit immer nur Beurteilbarkeit vermittels des Vermögens der ästhetisch reflektierenden Urteilskraft bedeutet.
|
| [18] |
|
Nach Ansicht A. Tumarkins ist der Begriff des »freien Spiels« nicht nur der ästhetisch reflektierenden Urteilskraft integriert, sondern bilde selbst den Mittelpunkt der Kantischen Ästhetik; denn »überall, wo die systematischen Grundfragen der ›Kritik der Urteilskraft‹ sich zuspitzen«, werde man auf das »Spiel der Kräfte« hingewiesen. Das »Spiel der Kräfte« sei das Prinzip, auf dem das Apriorische in der ästhetischen Betrachtung beruhe und das so die Ästhetik unter die allgemeine Frage bringe: »Gibt es synthetische Urteile apriori?«. (S.349)
Eine ähnliche Auffassung vertritt A. H. Trebels, der das Spiel im Zusammenhang mit der Einbildungskraft als die entscheidenden Faktoren bei der Bestimmung des reinen Geschmacksurteils und mithin für die Ästhetik Kants ansieht.
|
| [19] |
|
»KdU«, S.202
|
| [20] |
|
Man muss sich davor hüten, das Wort ›Schönheit‹ in einer Darlegung des Kantischen »freien Spiels« zu früh in Anschlag zu bringen, da sonst sehr leicht der Sachverhalt in einem verzerrten Bezug erscheinen kann.
Denn die Schönheit ist erst das Resultat eines Bewusstwerdungsprozesses und wird erst in der Benennung durch das ästhetische Urteil objektiviert und manifest. D. h., die Genese der Schönheit kann nicht so dargestellt werden wie es W. Sdun in einem Aufsatz tut, indem er sagt, dass kant, »um nun der Schönheit (...) eine Existenz zu sichern (...)« (S.502), sie vom Angenehmen und vom Guten unterscheide. Das trifft zwar zu, was jene Unterscheidung betrifft, verändert aber durch die Formulierung »eine Existenz zu sichern« die Kantische Analyseperspektive: Kant ist nicht in erster Linie mit einer Existenzsicherung der Schönheit beschäftigt, vielmehr geht es ihm darum, die Stellungnahme des Menschen in Bezug auf eine sich auf bestimmte Weise präsentierende Gestalthaftigkeit eines Gegenstandes zu untersuchen.
|
| [21] |
|
Wieweit allerdings die Herleitung des Spielbegriffs bei Schiller demjenigen Kants direkt verpflichtet ist, bzw. wieweit unmittelbare Übernahmen durch Schiller vorgenommen worden sind, kann hier nicht zur Erörterung anstehen. Es ist verwunderlich, dass bei der großen Anzahl von Abhandlungen über Schillers philosophische Anleihen bei Kant wie zur Auseinandersetzung Schillers mit Kant diese Frage bisher keiner eingehenden systematischen Bearbeitung unterzogen worden ist.
|
| [22] |
|
Es muss hinzugefügt werden, dass die als theoretische Möglichkeit für Schiller bezeichnete Bestimmung des »freien Spiels« durch Kant nur das Spezifische in Bezug auf die Herleitung des Schillerschen Spielbegriffs meint. Darüber hinaus sind aus der kritischen Philosophie Kants folgende Grundlagen als bedeutsam für Schillers philosophische Reflexion zu nennen: erstens eine bestimmte Untersuchungsperspektive, nämlich die radikale Wendung in das Individuum selbst; zweitens eine besondere Untersuchungsmethode, nämlich die transzendentale Methode; drittens das Prinzip der Autonomie des menschlichen Geistes.
|
| [23] |
|
Bereits in den sogenannten »Kallias-Briefen« von 1793 hat Schiller verkündet, »dass sich ein Begriff von der Schönheit geben lasse« (S.83) und glaube, er habe in seiner Formel, Schönheit sei Freiheit in der Erscheinung, ein objektives Prinzip der Schönheit gefunden. Diese Definition gilt seit den »Kallias-Briefen« in allen ästhetisch-theoretischen Schriften Schillers, so auch in den »Ästhetischen Briefen«. Dennoch insistiert Schiller darauf, dass »einen Begriff von der Schönheit zu geben und durch den Begriff der Schönheit gerührt zu werden« (S.83) zwei ganz verschiedene Dinge seien und leugnet mit Kant, »dass die Schönheit durch diesen Begriff gefalle« (S.83).
|
| [24] |
|
Es ist zweifellos richtig, wenn W. Janke die Deduktion – seit Kant als Rechtfertigung apriorischer Begriffe so genannt – allein auf diejenige der Schönheitsidee bezieht »und die einzige Art, sie methodisch in’s Werk zu setzen«, der transzendentale Weg sei (S.438). Aber da der Spielbegriff ebenfalls auf diesem Weg liegt und selbst ein apriorischer Begriff ist – wie noch zu zeigen sein wird –, kann die Bezeichnung ›Deduktion‹ auch auf ihn angewendet werden.
|
| [25] |
|
vgl. B Mugdan, S.33/34
|
| [26] |
|
Denn es ist Schiller nicht darum zu tun – wie etwa Kant - »eine klare Unterscheidung zwischen den verschiedenen ›Seelenkräften‹ zu treffen« und »eine exakte Grenzbestimmung ihrer Funktion« zu erstellen, wie es für eine Theorie der Erkenntnis im eigentlichen Sinn unerlässlich ist, »sondern ganz einfach das dynamische Wechselspiel zwischen zwei fundamentalen Aspekten der menschlichen Natur, Sinn und Geist, Natur und Freiheit« (S.399) aufzuzeigen. Diese von E. M. Wilkinson gemachte allgemeine Beobachtung ist auch in besonderem Maße auf den erkenntnistheoretischen Bereich des Spielbegriffs übertragbar und bei der Untersuchung zu beachten.
In der oben genannten Problematik ist auch der Grund zu sehen, warum in der Literatur so etwas wie eine erkenntnistheoretische Implikation im Spielbegriff kaum und wenn, immer nur zugleich in anthropologischen, kunst- und kulturphilosophischen Zusammenhängen behandelt worden ist.
|
| [27] |
|
»Ästh. Br.«, S.110
|
| [28] |
|
Hierin ist der Grund für die gewählte Reihenfolge der einzelnen Aspekte zu sehen, nämlich dass der erkenntnistheoretische dem anthropologischen wie dem erkenntnispraktischen Aspekt vorhergeht.
Bei Schiller von einer Sicherung der Existenz der Schönheit zu reden ist eher berechtigt; denn dass Schönheit vor jeder Begrifflichkeit präexistiere, wird von ihm nicht in Frage gestellt, nur »daß es dieselbe Schönheit sei« (S.110), von der Schiller in den »Ästhetischen Briefen« redet, wird bezweifelt.
|
| [29] |
|
»Ästh. Br.«, S.110
|
| [30] |
|
»Ästh. Br.«, S.110 – vgl. dazu »KdrV«, S.63, wo es heißt: Die »transzendentale Kritik« sei nicht die Erweiterung der Erkenntnisse«, sondern habe »nur die Berechtigung derselben zur Absicht (...)«.
|
| [31] |
|
»Ästh. Br.«, S.110
|
| [32] |
|
vgl. »KdrV«, S.63: »Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, sofern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt.«
|
| [33] |
|
»Ästh. Br.«, S.110
|
| [34] |
|
An mehreren Stellen in den »Ästhetischen Briefen« weist Schiller auf die Verdienste der Transzendentalphilosophie hin, so z. B. auf S.99: »Die Vernunft hat sich von den Täuschungen der Sinne und von einer betrüglichen Sophistik gereinigt (...)« oder S.119: die Transzendentalphilosophie habe die Form vom Inhalt befreit und das Notwendige von allem Zufälligen bereinigt. – W. Böhm sieht darin indessen eine »Replik« auf Fichte ausgedrückt, dem er »den indirekten Vorwurf der Buchstabenphilosophie« mache (S.42). – Oder an anderer Stelle sagt Schiller: »So wie in allem (...) hat die kritische Philosophie den Weg eröffnet, die Empirie auf Prinzipien, und die Spekulation zur Erfahrung zurück zu führen«. (Ästh. Br.«, S.128, Anm.)
|
| [35] |
|
vgl. B. Mugdan, S.36
|
| [36] |
|
»Ästh. Br.«, S.144
|
| [37] |
|
»Ästh. Br.«, S.112
|
| [38] |
|
»Ästh. Br.«, S.112
|
| [39] |
|
»Ästh. Br.«, S.116 – Schillers Formulierung scheint die auf eine einzige Formel gebrachte Kantische Theorie der Erkenntnis zu sein. Das, was Kant in äußerst differenzierter Analyse erarbeitet hat, erfährt bei Schiller eine seinen eigenen Zwecken adäquate Zusammenfassung und kann als ein Beispiel für seine eigentümliche Anwendung Kantischer Grundsätze angesehen werden. Zu dem Problem der Aneignung Kantischer Grundideen sagt E. Cassirer ganz allgemein, dass »Schiller (...) die Kantischen Begriffe und Lehren seiner eigenen Geistesform gemäß gestaltet« habe (S.85).
Um die Behauptung von dem formelhaften Charakter der Schillerschen Äußerung nur einigermaßen untermauern zu können, seien einige skizzenhafte Bemerkungen zum Begriff ›Erfahrung‹ bei Kant gemacht. Der Begriff der Erfahrung strukturiert sich bei Kant folgendermaßen:
Erstens und im weiteren Sinne ist Erfahrung einesteils die bloße Wahrnehmung und das durch sie Gegebene und kennzeichnet nichts weiter als die zwar synthetische, dennoch unstrukturierte Aneinanderreihung von diffusen Anschauungen und führt zu gar keiner Erkenntnis, nicht einmal zur Erfahrungserkenntnis; andernteils wird unter Erfahrung auch das von den Wahrnehmungen Abstrahierte bzw. das aus ihnen vermittels Induktion Gewonnene verstanden und ist folglich die durch Verstandestätigkeit auf einen synthetischen Gegenstandsbegriff gebrachte bewusste Wahrnehmung, mithin die Erfahrungserkenntnis. Diese Art der Erfahrung hat jedoch nur komparative, d. h. nicht strenge Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit, denn sie ist wandelbar, aber nichtsdestoweniger ein unentbehrliches Faktum der Erkenntnis schlechthin.
Zweitens handelt es sich bei der im engeren Sinne verstandenen Erfahrung um den logisch-allgemeingültigen Zusammenhang von Wahrnehmungsdaten und den Prozess der Verknüpfung solcher Daten zu objektiven synthetischen Begriffen apriori. Das bedeutet, dass diese Erkenntnisqualität ein Wissen voraussetzt sowohl um das rein Empirische als auch um das Apriorische. Die Zusammengesetztheit zur Erfahrungserkenntnis beweist, dass die Erfahrung selbst nicht absolut gegeben ist; vielmehr stellt sie die logische, verstandesmäßige Verarbeitung sinnlicher Eindrücke dar vermittels der apriorischen Anschauungsformen Raum und Zeit.
Zusammengefasst heißt das: Erfahrungserkenntnis ist ein unveräußerliches Faktum zur Erkenntnis von Gegenständlichkeit; denn alle Erkenntnis hebt mit der Erfahrung an und ist eine in der Erfahrung fortschreitende – und wird logisch notwendig bedingt durch die transzendentalen Prinzipien apriori. Erfahrung als solche ist der Ausgangspunkt des Erkenntnisprozesses, an dessen Endpunkt die transzendentale Erkenntnis steht.
|
| [40] |
|
B. Mugdan, S.37
|
| [41] |
|
B. Mugdan, S.37
|
| [42] |
|
B. Mugdan, S.37
|
| [43] |
|
»Ästh. Br.«, S.142
|
| [44] |
|
»(...); durch die es aber Schiller gelingt, weitläufige Gebäude von Prämissen und Konklusionen aufzuführen«. (W. Böhm, S.38)
Otto Kühne nimmt die »Polarität« der Argumentationsstruktur zum Anlass, die »Ästhetischen Briefe« ganz aus dem Blickwinkel der Polaritätstheorie zu interpretieren.
|
| [45] |
|
W. Böhm, S.39
|
| [46] |
|
»Ästh. Br.«, S.114
|
| [47] |
|
»Ästh. Br.«, S.114
|
| [48] |
|
»Ästh. Br.«, S.114
|
| [49] |
|
Dass Schiller den Triebbegriff augenscheinlich von Fichte entlehnt hat, ist eine feststehende Tatsache, zumal Schiller selbst Fichtes Werk, Grundlagen der gesamten Wissenschaftslehre, anführt (vgl. S.118, Anm.), und ist in der Literatur auch ausführlich belegt worden.
|
| [50] |
|
W. Böhm, S.33
|
| [51] |
|
»Ästh. Br.«, S.114
|
| [52] |
|
»Ästh. Br.«, S.115
|
| [53] |
|
»Ästh. Br.«, S.116
|
| [54] |
|
»Ästh. Br.«, S.116
|
| [55] |
|
»Ästh. Br.«, S.114
|
| [56] |
|
»Ästh. Br.«, S.119
|
| [57] |
|
»Ästh. Br.«, S.125
|
| [58] |
|
»Ästh. Br.«, S.125
|
| [59] |
|
»Ästh. Br.«, S.129
|
| [60] |
|
»Ästh. Br.«, S.116
|
| [61] |
|
»Ästh. Br.«, S.116
|
| [62] |
|
»Ästh. Br.«, S.116
|
| [63] |
|
»Ästh. Br.«, S.116
|
| [64] |
|
»Ästh. Br.«, S.116
|
| [65] |
|
»Ästh. Br.«, S.117
|
| [66] |
|
»Ästh. Br.«, S.117
|
| [67] |
|
»Ästh. Br.«, S.119
|
| [68] |
|
»Ästh. Br.«, S.119
|
| [69] |
|
»Ästh. Br.«, S.125
|
| [70] |
|
»Ästh. Br.«, S.125
|
| [71] |
|
»Ästh. Br.«, S.129
|
| [72] |
|
... und da steht er in der Tradition des neuzeitlichen Denkens, das die endgültige Spaltung im Bewusstsein des Individuums in Sinnlichkeit und Vernünftigkeit vollzogen hat ...
|
| [73] |
|
»Ästh. Br.«, S.117 – Schiller hat damit wohl kaum gemeint, dass die essentielle Gegensätzlichkeit der Triebe ein für allemal und endgültig zu beheben sei und für nichtig erklärt werden könne; denn das hieße einer schimärischen Vorstellung huldigen, weil im endlichen Menschen Sinnesvermögen und Verstandesvermögen ewig zwei getrennte Bereiche sind und als solche für die menschliche Erkenntnis notwendig getrennt sein müssen.
|
| [74] |
|
»Ästh. Br.«, S.118
|
| [75] |
|
»Ästh. Br.«, S.124
|
| [76] |
|
»Ästh. Br.«, S.118 Anm.
|
| [77] |
|
»Ästh. Br.«, S.118 Anm.
|
| [78] |
|
»Ästh. Br.«, S.123 – Was für die Bezeichnung ›Trieb‹ gesagt wurde, gilt auch für diejenige der ›Wechselwirkung‹, nämlich wieweit dieser Begriff direkt von Fichte übernommen ist oder ob Schiller mit ihm ebenso verfährt wie er es bei vielen Begriffen Kantischer Prägung tut, muss hier offen bleiben.
|
| [79] |
|
»Ästh. Br.«, S.122
|
| [80] |
|
»Ästh. Br.«, S.123
|
| [81] |
|
Diese Benennung erfolgt in Anlehnung an E. Cassirer, der folgendermaßen argumentiert: zwar gehe die dialektische Methode durch Schillers sämtliche philosophische Schriften hindurch, indessen sei sie »für ihn kein totes und gleichförmiges Schema (...). Und (...) alles wahrhaft dialektische Denken [ist] dialogisches Denken. Ein solches dialogisches Denken ist es, das auch Schiller in höchstem Maße besaß.«. (S.108/09)
Es scheint der Besonderheit des Spieltriebes deshalb adäquater zu sein, ihn als dialogisch konzipierten Begriff zu bezeichnen. Zwar mag man mit G. Lukàcs der Ansicht sein, dass in Schillers Ästhetik im Ansatz eine Dialektik vorhanden sei und folglich auch in der Spielbegriffskonzeption, aber es muss hier doch der Meinung G. Rohrmosers zugestimmt werden, Schiller habe prinzipiell noch undialektisch im eigentlichen Hegelschen Sinn gedacht. Ebenso weist I. Kowatzki nach, dass Schillers Spieltrieb eher einem synthetischen Postulat, denn einer dialektischen Synthese gleichkomme; denn der Formtrieb sei nicht, wie bei einer »echten dialektischen Ableitung« (S.47), im Stofftrieb oder der Stofftrieb im Formtrieb als Widerspruch enthalten, aus dem dann eine dialektische Bewegung erwachsen könne.
|
| [82] |
|
»Ästh. Br.«, S.125
|
| [83] |
|
»Ästh. Br.«, S.124
|
| [84] |
|
»Ästh. Br.«, S.124
|
| [85] |
|
Weder I. Kowatzki noch W. Böhm halten es für vertretbar, von einem ›neuen Trieb‹ zu reden und kommen zu diesem Ergebnis aus unterschiedlichen Gründen. Für I. Kowatzki ist der Spieltrieb deshalb »kein neuer höherer Gesichtspunkt der Vereinigung des Widerspruchs« (S.47), weil er nicht einer »echten dialektischen Ableitung« (S.47) entsprungen sei und somit die Vereinigung sich nicht »als neue These auffassen ließe, der eine neue Antithese entgegenträte« (S.47). Dies geht aber von der falschen Voraussetzung aus, dass Schiller einen dialektischen Spieltrieb habe entwickeln wollen. W. Böhm kritisiert, es sei unlogisch, dass auf der einen Seite »die beiden anderen Triebe in einem dritten Triebe zusammenwirken können« (S.46), auf der anderen Seite, dass der Spieltrieb »jedem der ersten (...) entgegengesetzt sein kann« (S.46). Hier wird offensichtlich nicht berücksichtigt, dass der Spieltrieb ausschließlich durch Formtrieb und Stofftrieb konstituiert ist und diese antagonistisch sich verhalten bzw. unter dem Wechselverhältnis sich ergänzen. Ferner – so W. Böhm – sei der Spieltrieb »Bestimmung reiner Funktion« (S.46) und könne »von Inhalten gar nicht gesondert existieren«, was bedeute, dass der Spieltrieb sowohl dem Formtrieb als auch dem Stofftrieb »in jedem Fall anhängend« (S.46) sei. Dieses Argument übersieht, dass der Spieltrieb gerade weil er durch die beiden Triebe allein bestimmt ist, d. h. deren Inhalte, Formalität und Realität, in sich aufnimmt, diesen auch anhängend ist und die Inhalt jener per definitionem funktional zur Einheit bringt und deshalb eine neue Konstellation der Grundtriebe im ›neuen‹ Trieb, dem Spieltrieb, zur Wirkung bringt. Nur dann muss man I. Kowatzki und W. Böhm zustimmen, der Spieltrieb sei kein neuer Trieb, wenn darunter ein selbstständiger, d. h. weder vom Formtrieb noch vom Stofftrieb abhängiger Trieb verstanden wird. Aber gerade das ist nicht der Fall und von Schiller keineswegs intendiert.
|
| [86] |
|
Es mag sein, dass dem in der Tat so ist, aber es ist die Frage zu stellen, wieweit dem Verständnis der »Ästhetischen Briefen« und deren Aussagen mit der Stringenz logischer Analyseverfahren gedient sei und nicht vielmehr im Gegenteil dadurch genau das erreicht werde, was schon Schiller selbst zu vermeiden suchte, nämlich, dass durch »technische Form (...) die Wahrheit dem Verstande versichtbart«, aber »dem Gefühl« verborgen bleibe (S.78). Viel wesentlicher erscheint es, ob ein logischer Sinnzusammenhang besteht, und ein solcher ist durchaus vorhanden.
|
| [87] |
|
vgl. dazu A. H. Trebels, der auf die Nähe des Spielbegriffs zu dem »freien Spiel« Kants hinweist, indem er den Formtrieb in die Nähe des Verstandes als Vermögen des Denkens und den Stofftrieb in die Nähe der Einbildungskraft als Vermögen der Sinnlichkeit stellt (S.207)
|
| [88] |
|
»Ästh. Br.«, S.127
|
| [89] |
|
»Ästh. Br.«, S.127
|
| [90] |
|
»Ästh. Br.«, S.127
|
| [91] |
|
Über die dritte und letzte Stufe lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nichts aussagen. Sie wird erst dann behandelt werden können, wenn es darum geht, Schillers angestrebtes Ziel: den »reinen Vernunftbegriff der Schönheit« (»Ästh. Br.«, S.110), zu untersuchen.
|
| [92] |
|
»Ästh. Br.«, S.127
|
| [93] |
|
A. H. Trebels, S.207 Anm.; denn das Wechselspiel im Spieltrieb bestehe für Schiller »wesentlich im Zusammenspiel, nicht im Spiel zwischen den Vermögen«.
|
| [94] |
|
So setzt etwa E. Fink den Beginn einer ersten ernsthaften Behandlung der Phänomene des Spiels und des Schönen im Denken Platons an. Indessen, für eine Wesensbestimmung des Menschen erlangen sie keine Relevanz; denn sowohl das Schöne als auch das Spiel sind jeweils von der Beschaffenheit des Menschen, folglich vom Erkennen, Wollen und Beurteilen absolut unabhängige Manifestationen. Beide ereignen sich außerhalb der psychologischen Sphäre des Individuums; denn das Schöne ist das ontische Abbild der übersinnlichen Idee der Einheit von Schönem, Gutem und Wahrem, während das Spiel als irreales Spiegelbild eines realen Sinnendinges aufgefasst wird und zwischen Original und Abbild sich bewegt.
|
| [95] |
|
vgl. K. H. Volkmann-Schluck, S.8
|
| [96] |
|
A. Nivelle, S.3
|
| [97] |
|
Zunächst jedoch wird, wie in A. G. Baumgartens »Ästhetica«, unter Ästhetik lediglich eine Wahrnehmungslehre schlechthin, eine Wissenschaft der Sinnenerkenntnis verstanden, die als niedere Erkenntnistheorie die Logik ergänzen soll. An diese Festlegung lehnt sich auch die Kantische Ästhetik an, wenn Ästhetik als »die Wissenschaft von den Regeln der Sinnlichkeit« (»KdrV«, S.98) begriffen wird. Allerdings wird bei Kant die Ästhetik bereits dem Gefühlsvermögen zugeordnet, wodurch das Schönheitsphänomen in den Bereich der subjektiven Wahrnehmung als »freies Spiel der Erkenntnisvermögen« einbezogen wird. Aus dieser zweifachen Zuordnung erklärt sich gleichsam die traditionelle Abhängigkeit von erkenntnistheoretischen Positionen, die auch bei Schiller sehr stark zum Tragen kommt. Die Problematik der Erkenntnistheorie kehrt somit mittelbar in der Ästhetik wieder; denn wie diese ihre Gegenstände interpretiert, hängt davon ab, welchen Gegenstandsbegriff jene prinzipiell hat.
|
| [98] |
|
A. Baeumler, S.2
|
| [99] |
|
A. Baeumler, S.3
|
| [100] |
|
A. Baeumler, S.3
|
| [101] |
|
Ebenfalls ist das in der »KdrV« aufgestellte kritische Programm in der Einleitung der »Kritik der Urteilskraft« noch einmal auseinandergelegt. Und letzterer hat Schiller bekanntlich ein intensives Studium gewidmet, was zahlreiche Äußerungen in Briefen an Chr. G. Körner sowie die umfangreichen Marginalien in seinem Handexemplar der »KdU« belegen, sodass er mit dem kritischen Anliegen Kants durchaus vertraut gewesen ist (vgl. dazu zum einen die Ausgabe des Briefwechsels zwischen Schiller und Körner, zum anderen die »Materialien zu Kants ›Kritik der Urtielskraft‹«, hrsg. von J. Kulenkampff, S.126 – 144).
|
| [102] |
|
»KdrV«, S.63
|
| [103] |
|
»KdrV«, S.63
|
| [104] |
|
»KdrV«, S.62
|
| [105] |
|
»KdrV«, S.128
|
| [106] |
|
K. H. Volkmann-Schluck, S.11
|
| [107] |
|
Zu Beginn der »Ästhetischen Briefe« gibt Schiller diesbezüglich eine Rechtfertigung wie zugleich ein Aufzeigen der Problematik analytischer Verfahrensweisen – was nicht zuletzt auch als eine immanente Selbstverteidigung seiner eigenen Unternehmung anzusehen ist –, wenn er sagt, dass die »technische Form, welche die Wahrheit dem Verstande versichtbart, verbirgt sie wieder dem Gefühl; denn leider muß der Verstand das Objekt des inneren Sinns erst zerstören, wenn er es sich zu eigen machen will. Wie der Scheidekünstler so findet auch der Philosoph nur durch Auflösung die Verbindung (...) Um die flüchtige Erscheinung zu haschen, muß er sie in die Fesseln der Regeln schlagen, ihren schönen Körper in Begriffe zerfleischen, und in einem dürftigen Wortgerippe ihre lebendigen Geist aufbewahren. Ist es ein Wunder, wenn sich das natürliche Gefühl in einem solchen Abbild nicht wieder findet, und die Wahrheit in dem Berichte des Analysten als Paradoxon erscheint?« (»Ästh. Br.«, S.78) – Diese Stelle sollte allen jenen Schiller-Interpreten vorgehalten werden, die ihm, Schiller nämlich, mit Pedanterie, Diskontinuität in der Argumentation, so etwa K. Hamburger, nachzuweisen trachten und, wie W. Böhm es tut, »Kindlichkeit des Denkens« (S.34), »dilettantische Methode« (S.57) und »Begriffsmystik« (S.76) vorwerfen.
|
| [108] |
|
»Ästh. Br.«, S.119 Anm. – Diese Äußerung Schillers ist wohl zu beachten, will man seine Einschätzung bezüglich der Kantischen Philosophie in angemessener Weise verstehen.
|
| [109] |
|
So heißt es beispielsweise in dem resümierenden Urteil: »Das Zeitalter ist aufgeklärt, das heißt die Kenntnisse sind gefunden und öffentlich preisgegeben« (»Ästh. Br.«, S.99). Vgl. ferner die Anmerkung auf S.120/21, in der Schiller deutlich werden lässt, warum noch keineswegs von Erkenntnissen in seinem Verständnis die Rede sein kann, sondern selbst die »Erweiterung unserer Kenntnisse« aufgrund der Trennung (bzw. der Gebietsvertauschung) von Sinnlichkeit, »welche keine Form annimmt«, und Vernunft, »welche keinen Inhalt abwartet«, Schaden davon getragen habe.
|
| [110] |
|
»Ästh. Br.«, S.99
|
| [111] |
|
»Ästh. Br.«, S.96
|
| [112] |
|
»Ästh. Br.«, S.96 – Bei Schillers zweifacher Verwendung des Wortes »Natur« ist zu beachten, dass deren Bedeutungen in den beiden angeführten Zitaten keineswegs identisch sind. Im ersten Fall ist unter »Natur« sinngemäß die Aufspaltung des Menschen in Einzelkräfte gemeint, die zum Zweck des Gattungsfortschrittes unbedingt notwendig ist, jedoch dem Individuum zum Nachteil werden muss. Im zweiten Fall meint »Natur« das Gegenteil von Vereinzelung, nämlich die Gemeinschaft, die Zusammenstimmung der Kräfte im Individuum, welches Sinnenwesen und Vernunftwesen in einem ist.
Zum Problem der Vielschichtigkeit von Bedeutungsinhalten ein und desselben Wortes ist auf den sehr interessanten und für das Verständnis der sprachlichen Details der »Ästhetischen Briefe« aufschlussreichen Aufsatz von E. M. Wilkinson zu verweisen. Darin weist sie sehr genau nach, dass dieselben Termini in verschiedenen Sinnzusammenhängen verschiedene Bedeutungen beinhalten können. Bezüglich semantischer Probleme in der Terminologie Schillers sind neben der Arbeit von E. M. Wilkinson diejenigen von J. Wernly und O. Sayce als wertvolle Ergänzungen heranzuziehen. So zeigt etwa O. Sayce, ähnlich wie E. M. Wilkinson, dass Schiller keine philosophisch scharf bestimmte Sprache habe, »eher eine dichterischen Bedeutungsfülle« (S.176). Fast immer zeige sich das antithetische Prinzip »als entscheidend bei der Bestimmung der verschiedenen Bedeutungen« (S.176). Deshalb sieht O. Sayce das Ziel einer Untersuchung der sprachlichen Gegebenheiten bei Schiller darin, die verschiedenen Bedeutungen eines Wortes aufzudecken, nicht etwa »um Schiller der Inkonsequenz zu beschuldigen, sondern als Vorbedingung für ein tieferes Verständnis« (S.176); denn, so seine These, das Wissen um sprachliche Inkonsequenz könne logischen Fehldeutungen vorbeugen.
|
| [113] |
|
K. H. Volckmann-Schluck, der in seiner Interpretation von dem Begriff des ästhetischen Humanismus ausgeht, sieht in der unausgesprochenen Frage nach der Möglichkeit des Menschseins die eigentliche Hauptintention Schillers in den »Ästhetischen Briefen« thematisiert. Zwar – so räumt er ein – vermittelten die »Ästhetischen Briefe« tiefe Einsichten in das Wesen der Kunst, ebenso begründeten sie eine bestimmte Bildungsidee; aber weder allein auf eine Lehre vom Wesen der Kunst noch auf eine Grundlegung der Bildung ziele nach seiner Ansicht die thematische Absicht Schillers, sondern sie sei primär auf die Wesensbestimmung des Menschen bzw. die Möglichkeit des Menschseins gerichtet. Aus diesem Grund – so behauptet er – habe auch Schillers Auseinandersetzung mit der Philosophie Kants bei weitem nicht das Gewicht, das man ihr gewöhnlich beimesse (S.11).
I. Kowatzki dagegen sieht nicht nur eine Modifikation des Bezugs der transzendentalen Fragestellung Schillers im Vergleich zu Kant, sondern fasst den Unterschied schärfer, insofern als sie Schillers Frage in die Nähe einer Existenzphilosophie stellt, wenn sie sagt, dass Schiller sich zwar transzendentalphilosophischen Methode Kants bediene, aber »dessen epistemologische Sichtweise von der Möglichkeit des Erkennens überhaupt in existentiell-spekulative« umwandele, nämlich »in die Frage nach der Bestimmung der Möglichkeit der menschlichen Existenz« (S.42).
|
| [114] |
|
»Ästh. Br.«, S.110
|
| [115] |
|
»Ästh. Br.«, S.110
|
| [116] |
|
»Ästh. Br.«, S.85
|
| [117] |
|
»Ästh. Br.«, S.85
|
| [118] |
|
»Ästh. Br.«, S.85
|
| [119] |
|
vgl. »Ästh. Br.«, S.130 sowie W. Janke, S.439 – Damit ist eine Zirkelsituation aufgebaut, die allerdings in der Sache selbst begründet liegt. Auf dieses Problem wird noch zurückzukommen sein.
|
| [120] |
|
W. Janke, S.439
|
| [121] |
|
»Ästh. Br.«, S.111 – Für die Interpretation des Begriffspaares »Person - Zustand« nimmt W. Janke dessen dreifache Bedeutung bei Kant zu Hilfe. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass die psychologische Bestimmung der Begriffe für Schillers transzendentale Untersuchung nicht in Betracht komme, sondern dass die moralische, insbesondere die transzendentale für ihn die bedeutsameren Bestimmungen gewesen sind; denn »im transzendentalen Verstande (...) meint Person das Selbst des Selbstbewußtseins als Bedingung der Möglichkeit menschlicher Erkenntnis und Zustand das Bestimmtsein des an sich unbestimmten Subjekts durch das entgegengesetzte Objekt überhaupt« (S.440).
|
| [122] |
|
»Ästh. Br.«, S.111 – Da die Person »als absolute und unteilbare Einheit« nicht mit sich selbst in Widerspruch geraten kann und folglich »wir in alle Ewigkeit wir sind« (Ästh. Br.«, S.116), vollziehe Schiller den Übergang in die Metaphysik. Denn was von der Einheit in der Idee als der Grundbedingung des Objektivierens notwendig galt, das werde nach B. Mugdan nun auf die Einheit des Objekts bezogen. Das habe zur Folge – so B. Mugdan –, dass, »nachdem die absolute und unteilbare Einheit des Subjekts für das Bewußtsein als Grundbedingung der Erfahrung erwiesen ist, (...) diese Einheit aus einem Gedachten zu einem Objektiven gemacht« werde, »indem ihr die Unteilbarkeit nicht hypothetisch, d. h. sofern sie notwendige Bedingung für die Möglichkeit der Erfahrung ist, sondern absolut als ihre Eigenschaft zugesprochen wird« (S.57). Den Übergang in das Metaphysische, der sich auch darin zeige, dass die Einheit des Bewusstseins wie jedes Objekt unter den Satz des Widerspruchs gestellt werde – obgleich doch dies Grundgesetz der analytischen Einheit erst aus ihr als der synthetischen Einheit abgeleitet werden müsste –, belegt B. Mugdan mit einem Verweis auf Kant, der die analytische Einheit der Apperzeption nur unter der Voraussetzung irgend einer synthetischen als möglich ansieht, und kommt zu dem Resultat, dass in dem Personenbegriff eine doppelte Bedeutung enthalten sei, nämlich eine kritische und eine metaphysische (S.57). In der Bestimmung der Person durch die Eigenschaft der Freiheit sieht B. Mugdan zudem den Ort, an dem der metaphysische Freiheitsbegriff Schillers entspringe (S.58).
|
| [123] |
|
»Ästh. Br.«, S.111
|
| [124] |
|
W. Janke, S.440
|
| [125] |
|
»Ästh. Br.«, S.111 – Nach W. Janke untersucht Schiller den Menschen in »cartesischer Tradition«, nämlich als »ein spezifisches Wesen des Bewußtseins oder als einen endlichen Geist« (S.440). P. Kretschmer vermutet in dem oben angeführten Zitat eher einen Angriff Schillers, der sich gegen das cartesische »cogito ergo sum« zu richten scheine, u. z. deshalb, weil Schiller wohl annehme, Descartes beabsichtigte, mit dem Satz das Vorhandensein des Extensiven, also das den Schillerschen Stofftrieb Betreffende, belegen zu wollen (S.49).
|
| [126] |
|
W. Janke, S.440/41
|
| [127] |
|
»Ästh. Br.«, S.112
|
| [128] |
|
»Ästh. Br.«, S.112
|
| [129] |
|
»Ästh. Br.«, S.111
|
| [130] |
|
»Ästh. Br.«, S.112
|
| [131] |
|
»Ästh. Br.«, S.112
|
| [132] |
|
»Ästh. Br.«, S.112
|
| [133] |
|
»Ästh. Br.«, S.113
|
| [134] |
|
W. Sdun reduziert die Unterscheidung Schillers in Person und Persönlichkeit folgendermaßen: Für Schiller sei der Mensch als Person Gattung und Mitträger des objektiven Geistes. Persönlichkeit sei das Individuum und die Selbstverwirklichung des Menschen (S.510, Anm.).
|
| [135] |
|
Es muss hier auf die Austauschbarkeit und Gleichsetzbarkeit einzelner Begriffe in der Terminologie Schillers hingewiesen werden. So drücken die Begriffe Person und Zustand auch nach K. Hamburger dieselbe dualistische Auffassung vom Menschen aus, die sonst durch die Begriffspaare »Vernunft und Sinnlichkeit«, »Freiheit und Natur« bezeichnet war; allerdings beträfen jene weit mehr als diese die »spezifische Existenzproblematik« (S.142) des Menschen.
|
| [136] |
|
»Ästh. Br.«, S.112
|
| [137] |
|
»Ästh. Br.«, S.112
|
| [138] |
|
»Ästh. Br.«, S.112
|
| [139] |
|
vgl. dazu W. Sdun, S.510
|
| [140] |
|
»Ästh. Br.«, S.112
|
| [141] |
|
B. Mugdan, S.58
|
| [142] |
|
Mit dem Begriffspaar »Person und Zustand« habe Schiller in einer »sozusagen echten phänomenologischen Bestimmung« die die menschliche Existenz konstituierende Selbsterfahrung der, wie K. Hamburger es nennt, »personalen« Identität im Wechsel ihrer Zustände sowie diejenige in der Zeit beschrieben und habe darüber hinaus das Paradox erkannt, »das ein Geheimnis des Ichbewußtseins genannt werden kann«, nämlich dass das, was sich verändere, das eigene unveränderliche Ich sei (S.142).
|
| [143] |
|
»Ästh. Br.«, S.113
|
| [144] |
|
»Ästh. Br.«, S.113
|
| [145] |
|
vgl. W. Sdun, S.510
|
| [146] |
|
»Ästh. Br.«, S.113
|
| [147] |
|
»Ästh. Br.«, S.113
|
| [148] |
|
»Ästh. Br.«, S.113
|
| [149] |
|
»Ästh. Br.«, S.113
|
| [150] |
|
K. Hamburger, S.143
|
| [151] |
|
»Ästh. Br.«, S.113 – Nach Ansicht K. Hamburgers hätte es der von Schiller zuvor gegebenen phänomenologischen Bestimmung von Person und Zustand, durch die das Zusammenwirken des Ich- und Weltbewusstseins beschrieben wurde, kaum bedurft; u. z. deshalb nicht, weil die Begriffe Person und Zustand von Schiller wieder auf die »Fundamentalgesetze der sinnlich-vernünftigen Natur« zurückgenommen werden und durch die Kategorien »Realität« und »Formalität« ersetzt werden (S.142).
|
| [152] |
|
K. H. Volkmann-Schluck, S.10
|
| [153] |
|
K. H. Volkmann-Schluck, S.10
|
| [154] |
|
K. H. Volkmann-Schluck, S.10
|
| [155] |
|
Die Behauptung der Ersetzbarkeit eines Begriffs durch andere Begriffe stützt sich auf die bereits erwähnte Untersuchung von E. M. Wilkinson, in der sie überzeugend darlegt, dass verschiedene Begriffe ersetzbar bzw. austauschbar sind – und bei Schiller mitunter auch selbst ausgetauscht werden. Allerdings ist die auftretende Austauschbarkeit nur »bis zu einem gewissen Grad« (S.401) und nicht prinzipiell möglich. So sind beispielsweise die Begriffe »Vernunft«, »Verstand«, »Geist«, »Freiheit«, »Wille«, »Gesetz« bzw. »Empfindung«, »Gefühl«, »Sinne«, »Materie«, »Zeit« für ein und denselben Sachverhalt wechselseitig verwendet werden, welches dem jeweiligen Kontext bei Schiller entnommen werden kann. Desgleichen gilt auch mit Einschränkungen für »Person«, »Form«, »Gestalt«, »Ideen-Einheit« bzw. »Zustand«, »Stoff«, »Leben«, »Größen-Einheit«. Diesbezüglich sei es »bei der Lektüre Schillers ganz und gar verfehlt (...), wenn man bei irgendeinem dieser Begriffe verweilt und sich den Kopf darüber zerbricht, dessen genauen Bedeutungsbereich zu bestimmen« (S.401), und sie begründet das wie folgt: Denn »noch war die Leidenschaft nicht erwacht, Sprache gleichsam zu kastrieren« (S.399), und »ein Autor konnte von seinem Leser verlangen, ein Wort im kleineren wie im größeren Zusammenhang zu sehen und eine genaue Bedeutung aus der Dynamik des Satzgebildes (...), aus der Gliederung der verschiedenen Figuren, aus der Wechselwirkung von Wort auf Wort herauszulesen« (S.400). Und weiter vertritt E. M. Wilkinson die Ansicht: »Wenn Schillers Terminologie unexakt ist, so ist es keine willkürliche Unexaktheit, wenn inkonsequent, dann keine zufällige Inkonsequenz; wenn seine Gedankengänge unlogisch sind, so sind sie weit davon entfernt, sinnlos zu sein; wenn die Form seines Werkes verwirrt, so ist es eine höchst kunstreiche, bis ins kleinste gegliederte Verwirrung«; denn das Werk werde »von einer wohl definierten – wie auch definierbaren – Intention beherrscht und erfüllt, die dem sprachlichen Detail wie der Gesamtstruktur ihren unverkennbaren Stempel aufgedrückt« (S.399) habe.
|
| [156] |
|
vgl. dazu W. Janke, S.441/42
|
| [157] |
|
W. Sdun, S.511
|
| [158] |
|
»Ästh. Br.«, S.114
|
| [159] |
|
W. Janke meint, in Schillers »Analyse der Triebe« verberge sich ein »fataler Sachverhalt«, nämlich dass dieselben Kräfte, die durch »ihre Übereinkunft dem Menschen geglücktes Menschsein verschaffen sollen (...) sich gegeneinander zu wenden scheinen« (S.443). Die Ansicht, ein fataler Sachverhalt liege vor, hat ihren Grund darin, dass W. Janke das Triebverständnis Schillers in Analogie zu demjenigen Leibniz’ und Fichtes sieht und dann interpretiert; Trieb bedeute in »Schillers System das Streben, die im Gegensatz von Wesen und Wirklichkeit geschiedene Einheit des Menschen in einem zweifachen Antriebe zu derjenigen Einheit zu bringen, in der das menschliche Wesen total verwirklich ist« (S.443). Der Sachverhalt ist aber insofern nicht »fatal«, als Schiller nicht von Trieb schlechthin spricht, sondern er benennt von vornherein zwei Triebe, und die wenden sich in der Tat gegeneinander. Das heißt, Schillers Untersuchung der Triebe ist von Beginn an bewusst antithetisch aufgebaut und führt kontinuierlich zur Versöhnung der tendenziösen Entgegensetzung der zwei Grundtriebe.
|
| [160] |
|
Aufgrund der Tatsache, dass erstens Schiller einmal die beiden Triebe als voneinander unabhängige, ein anderes Mal als im Menschen vereinigte betrachtet, zweitens jene Triebe den Begriff der Menschheit ausfüllen und deshalb ein weiterer, dritter Trieb undenkbar ist, bedeute das nach H. Kössler »auf dem Boden der dualistischen Anthropologie eine contradictio in adiecto« (S.104).
Dem ist aber nicht so; denn – um es noch einmal klar auszudrücken – zum einen ist zu bemerken, und Schiller selbst weist mit Nachdruck darauf hin, dass die beiden Triebe nur in ihren Objektbereichen – und nur dort – unabhängig voneinander sind, nicht jedoch was die vollständige Einschätzung des Wesens des Menschen betrifft; zum anderen meint der Spieltrieb keinen dritten Grundtrieb, welches allein durch die optische wie durch die sprachliche Hervorhebung evident wird; ein solcher ist nämlich in der Tat »ein undenkbarer Begriff« (»Ästh. Br., S.117). Grundtriebe sind im Verständnis Schillers einzig und allein der Formtrieb und der Stofftrieb. H. Kössler widerspricht sich eher selbst, wenn er sagt, dass »andererseits (...) sich jedoch diese Doppelbedingung (Unabhängigkeit und Einheit beider ›Triebe‹) denken lassen« müsse, »wenn nicht schon die ›Idee‹ des Menschen selbst (...) ein undenkbarer Begriff sein soll, der Begriff nämlich eines vollendeten Widerspruchs« (S.104).
|
| [161] |
|
W. Janke, S.448
|
| [162] |
|
W. Janke, S.448
|
| [163] |
|
Hierin sieht W. Janke denn auch den alles entscheidenden Unterschied zur Wesensbestimmung des Menschen in der Tradition; denn diese nehme »den Antagonismus der Triebe nicht für eine tragische Möglichkeit, sondern für eine mechanische Notwendigkeit« (S.448), d. h., die Einheit des Menschen sei nur dadurch zu erhalten, wenn der sinnliche Trieb dem vernünftigen Trieb untergeordnet werde. Dadurch sei jedoch der Widerstreit »bloß gebändigt« und nicht gelöst und folglich bleibe »durch solche Maßnahmen ›der Mensch noch ewig fort geteilt‹ [Ästh. Br.«, S.118; Anm. v. Verf.]« (S.448).
|
| [164] |
|
Damit habe sich nach H. Kössler das anthropologische Denken umorientiert; denn es richte sich fortan nicht mehr am Begriff des Antagonismus aus, sondern an dem der Wechselwirkung zwischen beiden Trieben (H. Kössler, S.104/05).
|
| [165] |
|
»Ästh. Br.«, S.119
|
| [166] |
|
»Ästh. Br.«, S.124
|
| [167] |
|
»Ästh. Br.«, S.124
|
| [168] |
|
W. Janke, S.449
|
| [169] |
|
»Ästh. Br.«, S.124
|
| [170] |
|
K. H. Volkmann-Schluck, S.12
|
| [171] |
|
So vertritt beispielsweise F. Heuer die These, dass »nicht schon die Aufstellung des Spieltriebs, sondern erst die transzendentale Deduktion und Begründung des ästhetischen Zustands als Bedingung des Menschseins des Menschen« (S.125) den Kern der »Ästhetischen Briefe« bilden, und er belegt dies an einer Äußerung Schillers in dem Brief an Fichte vom 3. August 1795, dass erst die Briefe 19 – 23, in denen der ästhetische Zustand zur Behandlung kommt, den »Nervus der Sache« enthielten.
Dem kann indessen entgegengehalten werden, dass erst aufgrund des Ausgleichs zwischen beharrender Persönlichkeit und wechselndem Zustand im Spieltrieb allererst die Einheitsbasis in Kohärenz mit dem Schönheitsgegenstand für den ästhetischen Zustand konstitutiv gelegt wird.
|
| [172] |
|
vgl. »Ästh. Br.«, S.128 – vgl. K. H. Volkmann-Schluck, der in ähnlicher Weise argumentiert (S.13)
|
| [173] |
|
»Ästh. Br.«, S.117/18
|
| [174] |
|
K. H. Volkmann-Schluck, S.13/14
|
| [175] |
|
K. H. Volkmann-Schluck, S.14
|
| [176] |
|
W. Janke, S.449
|
| [177] |
|
»Ästh. Br.«, S.129 |
| [178] |
|
K. H. Volkmann-Schluck, S.14
|
| [179] |
|
K. H. Volkmann-Schluck, S.14
|
| [180] |
|
»Ästh. Br.«, S.112
|
| [181] |
|
vgl. W. Janke, S.433
|
| [182] |
|
»Ästh. Br.«, S.124/25 – Schillers Formulierung, »die Zeit in der Zeit aufzuheben«, nimmt W. Janke zum Ausgangspunkt seiner aufschlussreichen Interpretation der »Ästhetischen Briefe« und versucht von hier aus, Schillers transzendentalen Weg in der Philosophie der Schönheit zu erschließen. Er weist darauf hin, dass das Zeitproblem sich bei Schiller an exponierter Stelle befinde, dass »die Zeit und die Freiheit, d. i. der Wechsel von Zeitbezug und Zeitentzug der Angelpunkt seines Systems« (S.433) sei, welches einem Brief Schillers an Körner vom 29. Dezember 1794 entnommen werden könne.
Erinnert man sich an die dazu kontroverse These F. Heuers, so ist zu bemerken, dass jeweils die Blickrichtung des Interpreten bzw. die Fragestellung, unter der die »Ästhetischen Briefe« behandelt werden, darüber entscheidet, welcher Begriff, welche Aussage als der bzw. die zentrale anzusehen ist. Das Erstaunliche daran ist, dass der jeweilige Mittelpunkt, um den dann die Untersuchung kreist, sich entweder im Text selbst oder anhand von Äußerungen Schillers zu den »Ästhetischen Briefen« belegen lässt. Es ist wohl kaum zu weit gegangen, wenn man gerade darin ein wesentliches Charakteristikum der Struktur der »Ästhetischen Briefe«, d. h. das Freisein von jeder dogmatischen Intoleranz – auch in Bezug auf die Interpretation – erblickt.
|
| [183] |
|
W. Janke, S.442
|
| [184] |
|
vgl. W. Janke, S.442
|
| [185] |
|
»Ästh. Br.«, S.112
|
| [186] |
|
»Ästh. Br.«, S.143
|
| [187] |
|
K. H. Volkmann-Schluck, S.12
|
| [188] |
|
K. H. Volkmann-Schluck, S.12/13
|
| [189] |
|
Damit soll nicht gesagt werden, dass im Menschen nicht »eine Neigung (...) zum Spiele« (»Ästh. Br., S.174) vorhanden sei, wie Schiller auch selbst einräumt, nur ist es nicht das Spiel, von dem in dem Begriff des Spieltriebs die Rede ist.
|
| [190] |
|
»Ästh. Br.«, S.127
|
| [191] |
|
»Ästh. Br.«, S.101
|
| [192] |
|
»Ästh. Br.«, S.131
|
| [193] |
|
vgl. »KdU«, S.459 – »(...), da einem Begriffe, den nur die Vernunft denken, und dem keine sinnliche Anschauung angemessen sein kann, eine solche untergelegt wird, mit welcher das Verfahren der Urteilskraft demjenigen, was sie im Schematisieren beobachtet, bloß analogisch, d. h. mit ihm bloß der Regel dieses Verfahrens, nicht der Anschauung selbst, mithin bloß der Form der Reflexion, nicht dem Inhalte nach, übereinkommt.«
Es ist die Leistung Kants, dass er in seiner Transzendentalphilosophie die Vernunftidee der Menschheit mit der Wahrheit des Schönen zusammengebracht und den Symbolcharakter der Schönheit diesbezüglich aufgedeckt hat (vgl. in der »KdU« den bekannten § 59: »Von der Schönheit als Symbol der Sittlichkeit«). Mit der Bezeichnung ›Symbol‹ meint Kant vornehmlich das Sinnbild eines Übersinnlichen und mit »Symbolisieren« das besondere Verfahren bei der Versinnlichung einer Idee. Dieses Verfahren kann nur indirekt sein und beruht auf Analogiebildung. Der Symbolcharakter des Schönen besteht nach Kant darin, dass in ihren exemplarischen Produkten die Zwecke der Menschheit – gemeint ist die Sittlichkeit – werden (vgl. »KdU« § 17, S.313-318: »Vom Ideale der Schönheit«); denn aufgrund der Reflexion der ästhetischen Urteilskraft bezüglich der ästhetischen Zuständlichkeit des Subjekts in Anschauung des Schönen objektiviert sich per Analogie die Sittlichkeitsverfassung des Menschen. Das heißt, dass der Symbolcharakter des Schönen hinsichtlich der Sittlichkeit prinzipiell auf der Analogie basiert, die nach Kant zwischen der Heautonomie von Geschmack und Moralität besteht.
|
| [194] |
|
W. Janke weist darauf hin, dass dasjenige, was im Sinnbild offenbart werden soll, sich – im Vergleich zu Kant – bei Schiller verwandelt habe, und zwar werde nicht die »Idee des Menschen als Wesen moralischer Freiheit, sondern die Idee einer Wesenbestimmung von Form- und Stofftrieb (...) symbolisch, also indirekt in Reflexion auf eine analoge Verfassung erfahren«; was soviel heißt, dass der Mensch, der sich selbst Geheimnis ist (vgl. »Ästh. Br.«, S.124), »sich im Symbol entschleiert« (S.450).
|
| [195] |
|
»Ästh. Br.«, S.110
|
| [196] |
|
»Ästh. Br.«, S.124
|
| [197] |
|
»Ästh. Br.«, S.124
|
| [198] |
|
W. Janke, S.451/52
|
| [199] |
|
Zunächst soll damit ganz allgemein der schöne Gegenstand gemeint sein (Anm. v. Verf.)
|
| [200] |
|
»Ästh. Br.«, S.127
|
| [201] |
|
K. H. Volkmann-Schluck, S.14/15
|
| [202] |
|
Jenes freie Wechselspiel zwischen Empfindung und Denken ist hier dem Kantischen »freien Spiel der Erkenntnisvermögen« nicht unähnlich, weist aber über dieses hinaus.
|
| [203] |
|
K. H. Volkmann-Schluck, S.15
|
| [204] |
|
»Ästh. Br.«, S.130
|
| [205] |
|
»Ästh. Br.«, S.110
|
| [206] |
|
H. Kössler, S.107 – Und H. Kösslers Begründung lautet: »Denn wenn sich der Begriff der ›lebenden Gestalt‹ als die Idee der Schönheit aus der Idee des Menschen ›folgern‹ lassen soll, dann kann er eben per definitionem allein Vernunftbegriff einer menschlichen Schönheit sein.« (S.107)
|
| [207] |
|
»Ästh. Br.«, S.127
|
| [208] |
|
Es soll hier jedoch nicht die besondere Bedingung der Beurteilbarkeit erörtert werden, sondern allein die Beziehung der Schönheit in anthropologischer Bedeutung zur Wesensbestimmung des Menschen.
|
| [209] |
|
»Ästh. Br.«, S.131
|
| [210] |
|
Die Folgerung, die H. Kössler daraus zieht, heißt, dass der Vernunftbegriff der Schönheit nicht eigentlich die Idee der Schönheit selbst sei bzw. diese erkläre, sondern er sei es »aus keinem anderen angebbaren Grunde als diesem, weil wir immer und überall dann, wenn in einem Menschen die ›Idee der Menschheit‹ Wirklichkeit wird, ›ihn als schön beurteilen‹« (S.108).
|
| [211] |
|
»Ästh. Br.«, S.110
|
| [212] |
|
»Ästh. Br.«, S.128
|
| [213] |
|
»Ästh. Br.«, S.130
|
| [214] |
|
In der Tat liegt hier ein »gedanklicher Zirkel« (I. Kowatzki, S.44) vor, auf den sowohl K. Hamburger als auch I. Kowatzki aufmerksam machen.
Zwar nennt ihn K. Hamburger einen »bewußt aufgestellte[n] Zirkel« (S.141), folgert aber in verkürzter bzw. verkürzender Weise, dass »nun (...) gar nicht die Schönheit als Weg zur Menschheit aufgewiesen, sondern die Menschheit als Bedingung und Forderung für die Schönheit postuliert« (S.141) werde und in Anbetracht dessen mit Schillers ursprünglichem Ziel, der Möglichkeit einer wahren politischen Freiheit nichts mehr gemein habe. Dass dem keineswegs so ist, wird im weiteren Verlauf der Untersuchung noch gezeigt werden können.
Als verkürzt bzw. verkürzend ist diese Folgerung zu bezeichnen, weil die oben zitierte zweite Äußerung Schillers, in der ja gerade die Schönheit dem Spieltrieb und damit der Menschheit vorausgesetzt ist, nicht berücksichtigt wird; zum zweiten schenkt K. Hamburger der »rhetorischen Lieblingsfigur, dem Chiasmus« (S.412), wie ihn E. M. Wilkinson in ihrer Studie »Zur Sprache und Struktur der Ästhetischen Briefe« eindrücklich nachweist, offensichtlich keinerlei Bedeutung. Denn dieser »Zirkel« bzw. diese Kreuzstellung drückt den »Perspektivismus« (E. M. Wilkinson, S.411) Schillers aus, d. h. den jeweiligen Standpunkt, von dem aus die Sache betrachtet wird. Eher ist der Interpretation I. Kowatzkis zuzustimmen, die sagt, dass auf der einen Seite »die subjektiven Bedingungen für die Möglichkeit der Schönheit (...) mit der menschlichen Natur« (S.44), d. h. mit dem Vermögen von Sinnlichkeit und Vernunft gegeben seien und auf der anderen Seite die Bedingung zur Möglichkeit für ein volles Menschsein an die Wirkungsweise der Schönheit geknüpft sei, denn diese lasse den Menschen die geforderte Seinstotalität allererst in Erfahrung bringen (vgl. I. Kowatzki, S.44/45).
Was hier für die wechselweise Bedingung und Bedingtheit von Schönheit und Menschheit gesagt wurde, ist bei Schiller auch an anderen Begriffsbeziehungen zu beobachten, und es kann mit E. M. Wilkinson ganz allgemein gesagt werden, dass, »wenn Kritiker sich beklagen, daß er bald das eine bald das andere an die Spitze seiner Werteskala stellt«, sie dabei übersehen, »daß Schiller nicht mit einer festen Rangordnung operiert, vielmehr mit einer, die sich bei wechselnder Perspektive auch selbst verändert« (S.412). Im Hinblick auf die Zirkularität –, die E. M. Wilkinson übrigens als eine charakteristische Denkstruktur Schillers in den »Ästhetischen Briefen« ansieht (vgl. S.415/16), – bedeutet das, dass bei Schiller nicht nur kausal eines aus dem anderen hervorgeht und dann in notwendiger Progression geradlinig verläuft, sondern es ist gerade bei ihm angezeigt, wenn eine Kausalität vorzuliegen scheint, stets auch zugleich nach ihrer Umkehrung, d. h. nach ihrer Rück- bzw. Wechselbeziehung zu fragen und seiner häufig kreisförmigen Argumentation Rechnung zu tragen – obgleich zugegebenermaßen, insbesondere bei einer systematischen Untersuchung, dies nicht immer geleistet werden kann.
|
| [215] |
|
Weshalb H. Kössler auch von einer »Anthropologie der Schönheit« im Zusammenhang mit der Idee des Menschen spricht (vgl. S.102-108).
|
| [216] |
|
»Ästh. Br.«, S.131
|
| [217] |
|
vgl. »Ästh. Br.«, S. 77
|
| [218] |
|
K. H. Volkmann-Schluck, S.11
|
| [219] |
|
vgl. »KdrV«, S.45: »Daß alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel (...).«
|
| [220] |
|
Wenn hier vom Wohlgefallen am Schönen die Rede ist, so muss dabei das Kantische Argument der transzendentalen Subjektivität mitgedacht werden; denn allein das fühlende Bewusstsein, die ästhetisch reflektierende Urteilskraft besetzt mit ihrem Geschmacksurteil allererst den Gegenstand der Anschauung mit dem Prädikat »schön«.
|
| [221] |
|
Das konstitutive Element des Sittengesetzes ist nach Kant das Prinzip der Autonomie. Sie ist die Bestimmungsgrundlage der Sittlichkeit und mithin die Bekundung der Freiheit des Menschen als Vernunftwesen. Der reine Wille zur moralischen Handlung ist autonom und nicht etwa determiniert durch außerhalb der Subjektivität des Menschen angesiedelte Instanzen, d. h. er bestimmt sich aus sich selbst, u. z. durch den praktischen Gebrauch des Vernunftvermögens.
|
| [222] |
|
Die Möglichkeit zum Symbol bezüglich der Sittlichkeit kommt darin zum Ausdruck, dass Kant das Geschmacksurteil und die durch dieses bezeugte Schönheit ins Übersinnliche transzendiert. Denn das Geschmacksurteil erschöpft sich nicht nur in der Anwendung der Bestimmungsgründe des Schönen, d. h. das Geschmacksurteil ist nicht nur der Ausdruck jener Bestimmungsgründe, sondern erfährt seine vollständige Bedeutung in dessen Transzendentalität, in der ästhetischen Idee, dem Schönheitsideal, die ihr Pendant in der intellektuellen Idee, dem Vollkommenheitsideal, findet.
Dadurch, dass durch das ästhetische Wohlgefallen die Schönheit aufgrund der ästhetischen Idee von ihrer gefühlstheoretischen Isoliertheit befreit und in Verbindung mit dem intellektuierten Wohlgefallen gebracht wird und somit im Transzendentalen ihre Verankerung erfährt, erhält die Schönheit letztendlich ihren potentiellen Symbolwert für die Sittlichkeit.
|
| [223] |
|
»Ästh. Br.«, S.81
|
| [224] |
|
»Ästh. Br.«, S.158
|
| [225] |
|
Schiller nennt denn auch seine »Ästhetischen Briefe« in einem Schreiben an Chr. Garve vom 25. Januar 1795 sein »politisches Glaubensbekenntnis« (zit. nach U. Wertheim, S.437). Diese Äußerung erfährt in der marxistischen Schillerinterpretation besondere Hervorhebung (vgl. auch H. G. Thalheim, S.141); sie jedoch zum alleinigen Aufhänger für die Kritik an den »Ästhetischen Briefen« zu machen, stellt eine einseitig ausgerichtete Verkürzung der Aussagen Schillers dar.
Bleibt diese Briefstelle andererseits unbeachtet, so kann das ebenso leicht zu einer etwas fragwürdigen Einschätzung führen wie etwa bei K. Hamburger, wenn sie nämlich Schillers Verweis auf die Zeitgeschehnisse mehr oder weniger als eine Geste der Konzession im Hinblick auf den Adressaten der »Ästhetischen Briefe« auslegt und behauptet, dass »der mit dem Problem der Schönheit beschäftigte Dichter, der über diesen Gegenstand an eine fürstliche Person schrieb«, es für angezeigt gehalten habe, »den Blick zunächst auf den politischen Schauplatz zu richten (...)« (S.138). Eine ähnliche Ansicht vertritt F. Böversen (vgl. S.454/55).
Das mag vielleicht noch für die »Briefe an den Augustenburger« von 1793 Gültigkeit haben; aber weder auf die sogenannte »Horen-Fassung« von 1795 noch auf die endgültige Fassung (abgedruckt und selbst redigiert von Schiller in den »Kleinen prosaischen Schriften«, 1801) trifft das wohl kaum zu, zumal bereits in der »Horen-Fassung« Schiller die bezeichnende Anmerkung hinzugefügt hat: »Diese Briefe sind wirklich geschrieben; an Wen? tut hier nichts zur Sache (...) Da man alles, was eine lokale Beziehung hatte, für nötig fand, zu unterdrücken« (»Ästh. Br.«, S.77 Anm.). Vielmehr scheint die Ansicht Fr. Burschells zuzutreffen, dass durch den nicht mehr namhaft gemachten Empfänger die Briefe eine Distanz wahren, »die Schiller jetzt nötig erschien, um sich ohne Rücksicht auf eine besondere Person aussprechen zu können« (S.366).
|
| [226] |
|
H. Mayer betont, Schiller sei es in den »Ästhetischen Briefen« zum ersten Mal gelungen, »die unhistorische Abstraktheit der ästhetischen Spekulation mit der Analyse geschichtlicher Tagesereignisse zu verbinden«, wodurch in Schiller gleichsam spekulative Kräfte freigesetzt seien, »denn es gelingt, sowohl dem Geschichtsmaterial wie dem Kantianismus gebührenden Anteil am spekulativen Ertrag zu bewilligen« (S.821/22).
Auch aus dem Grund, dass Schiller, »um seinen Forderungen (...) größere Überzeugung geben zu können« (S.367), den Charakter des Zeitgeistes in den »Ästhetischen Briefen« kritisiere, wie Fr. Burschell ausführt, ist der historische Bezug unbedingt zu berücksichtigen.
|
| [227] |
|
Da Schillers Äußerungen zur Französischen Revolution in seinen Briefen und philosophischen Schriften keineswegs eindeutig zu nennen seien, wie H. G. Thalheim (S.118) bemerkt, und vornehmlich »indirekten Zeugnisse[n]« (B. v. Wiese, S.156) zu entnehmen seien, zeigen auch die Auffassungen in der Literatur über Schillers Stellung zur Französischen Revolution ein kontroverses Bild, das aber hier nachzuzeichnen nicht der Ort ist.
Es sei an dieser Stelle nur soviel gesagt, dass eine grob simplifizierte Einteilung im Wesentlichen zwei Deutungsrichtungen ergibt: Die eine ist die marxistisch orientierte, die auch die größere Anzahl von Arbeiten zu jenem Problem stellt und für sich in Anspruch nimmt, der wahre Erbe Schillers, trotz dessen Inkonsequenzen und ideologischer Schwächen, zu sein, indem sie ihn im dialektischen Materialismus aktualisiere und die politische Realisierung des eigentlichen Anliegens Schillers vollziehe und ferner, den es »vor einer reaktionär-politischen Verfälschung zu bewahre« gelte (H. G. Thalheim, S.145; vgl. auch G. Lukács, S.40). Die andere Richtung dagegen, die der Einfachheit halber als die nicht-marxistische Literaturkritik bezeichnet ist, macht geltend, dass Schillers sogenannte ideologischen Schwächen gerade in der Abkehr von jedem politisch-ideo-logischen Denken begründet seien und er nicht als Revolutionsherold angesehen werden kann und »zum Vorläufer einer totalitären Staatsgesinnung und eines national-staatlichen Denkens« (B. v. Wiese, S.157) gemacht werden dürfe.
|
| [228] |
|
»Aufgeklärt« soll hier im Sinne E. M. Wilkinsons verstanden werden, nämlich als »ein freier Spürsinn für Dogmatismus«, d. h. als ein »tiefer Verdacht gegen alle Absoluta«, als »eine immer wieder sich einstellende Besinnung auf das Ganze und ein damit verbundenes Geltenlassen von scheinbaren Gegensätzen«, wie etwa »Skepsis und Hoffnung, Theorie und Praxis, Analyse und Synthese« (S.46). In diesem Sinne sei Schiller nach Ansicht E. M. Wilkinson in hohem Maße Aufklärer, was sich an vielen Stellen in den »Ästhetischen Briefen« belegen lasse; denn niemand habe sich vor »dem Drohgespenst eines neuen Dogmatismus« entschlossener zu bewahren bemüht als Schiller, »niemand, dem es lebhafter bewußt wäre, daß das Zeitalter, das so viel getan hatte, den Starrkrampf der Tradition zu lösen und Autorität zu stürzen, selbst in unmittelbarer Gefahr stand, neue Autoritäten aufzurichten« (S.46).
|
| [229] |
|
Der für Schiller entscheidende Bruch zwischen den die Revolution begründeten Ideen und der Wirklichkeit, d. h. den tatsächlichen Geschehnissen, war der Prozess gegen den König, der mit dessen Hinrichtung seinen Abschluss fand. Dieses Ereignis führte denn auch bei Schiller zur entschiedenen Abkehr von der Französischen Revolution; denn Ludwig XVI. war als Schwächling bekannt, weshalb Schiller seine Hinrichtung offenbar als einen überflüssigen Gewaltakt ansah (vgl. U. Wertheim, S.437). Die Abkehr führt H. G. Thalheim darauf zurück, dass Schiller aufgrund der aus den deutschen Verhältnissen und dem subjektiven Idealismus resultierenden Revolutionskonzeption von vornherein nicht in der Lage gewesen sei, »den klassischen Charakter der bürgerlichen Revolution in Frankreich zu verstehen« (S.130), weshalb »seine Kritik des Vernunftstaates der Französischen Revolution (...) eine Kritik der beschränkten bürgerlichen Vernunft« vorstelle, »einer bürgerlichen Klasse, die die Utopie nicht zu realisieren vermag« (S.139). Dies ist ein sehr hartes Urteil und trifft vom marxistischen Standpunkt aus heutiger Sicht sicherlich zu.
Auch B. v. Wiese macht darauf aufmerksam, dass das Faktum der Revolution allererst »den Unterschied zwischen der die Französische Revolution legitimierenden Aufklärung und der aus dem schwäbischen Boden herausgewachsenen Schillerschen Aufklärung« (S.152) voll in Erscheinung treten lasse insofern als in Württemberg »die Ideen der Aufklärung lange Zeit assimiliert werden konnten, ohne daß damit ein radikaler Bruch mit der Vergangenheit verbunden war« (S.152). Hinzu kommt sehr wesentlich, was hier allerdings nur angemerkt werden kann, Schillers tiefe religiöse Verwurzelung.
|
| [230] |
|
»Ästh. Br.«, S.79
|
| [231] |
|
Das »Gebäude des Naturstaates« unbesehen mit dem des Feudalabsolutismus des 18. Jahrhunderts gleichzusetzen, wie G. Lukács es tut (vgl. S.14), ist nicht ganz unproblematisch, und es fragt sich, ob diese Gleichsetzung tatsächlich adäquat ist; es scheint eher, dass damit eine einseitig verkürzte, ideologische Verzerrung vorliegt, dem hier jedoch aufgrund einer anderen Themenstellung nicht weiter nachgegangen werden kann.
|
| [232] |
|
»Ästh. Br.«, S.87
|
| [233] |
|
Gerade diese Wendung Schillers ins Ästhetische hat ihm insbesondere seitens der marxistischen Interpretation herbe Kritik eingebracht. Denn dadurch, dass Schiller auf den revolutionären Weg verzichte, »weil die Völker seiner Zeit noch nicht reif zu einer Selbstbefreiung zu sein scheinen« (H. G. Thalheim, S.142) und »er sich der Bildung und ästhetischen Erziehung des Menschen widme, läßt er gleichzeitig die bestehenden Verhältnisse auf sich beruhen und verzichtet auf unmittelbare soziale und politische Veränderung« (S.142). In gleicher Weise argumentiert G. Lukács, wenn er sagt, dass Schiller »mit Hilfe der ästhetischen Erziehung die wirklichen Menschen wirklich« (S.19) umwandeln zu können, ein Programm zur Vermeidung der Revolution aufgestellt und dadurch das Problem der »Zerrissenheit und Zerstückelung des Menschen« (S.29) »auf den Kopf gestellt« (S.30) habe, indem er es aus der »ökonomisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit« (S.29/30) zurückgenommen und in die idealistische Denkweise verflüchtigt habe. Diese »Verflüchtigung« (S.29) führt zu dem Urteil, Schiller habe »nichts anderes als einen politischen Kompromiß« (H. G. Thalheim, S.143) vollzogen, der »im Hinblick auf die Französische Revolution reaktionär« sei, indessen für Deutschland, »wo keine revolutionäre Situation gegeben ist, trotzdem ihre Funktion als ideologische Vorbereitung der künftigen bürgerlichen Revolution« (S.143) behalte.
|
| [234] |
|
»Ästh. Br.«, S.79
|
| [235] |
|
»Ästh. Br.«, S.79
|
| [236] |
|
»Ästh. Br.«, S.81
|
| [237] |
|
Fr. Burschell, S.316
|
| [238] |
|
»Ästh. Br.«, S.83
|
| [239] |
|
»Ästh. Br.«, S.83
|
| [240] |
|
»Ästh. Br.«, S.84
|
| [241] |
|
»Ästh. Br.«, S.84
|
| [242] |
|
Mit der Kontrastierung des »wirklichen« Menschen zum »problematischen« habe nach I. Kowatzki »Schiller ein Problem formuliert, das die totale Revolution unserer Zeit vergeblich zu umgehen sucht« (S.43 Anm.).
|
| [243] |
|
»Ästh. Br.«, S.82
|
| [244] |
|
»Ästh. Br.«, S.81
|
| [245] |
|
»Ästh. Br.«, S.82/83 – Nach K. Hamburger sei es indessen »von einem empirisch historischen oder anthropologischen Gesichtspunkt aus« (S.139) nicht einsehbar, warum »die Leiter der Natur« dem Menschen »unter seinen Füßen (...) weggezogen« werde, »wenn ihm Gesetze gegeben werden« (S.139). Ein solcher Einwand resultiert erstens aus dem als vordergründig veranschlagten Bezug Schillers zur Französischen Revolution, womit er doch gerade auf die sich in ihr aufgetane Unfähigkeit des Menschen, einen Vernunftstaat direkt aus dem Naturstaat aufzurichten, hinweist; zweitens daraus, dass ein ungenaues Verständnis vorliegt, wenn K. Hamburger Schiller dahingehend auslegt, als werden dem Menschen im Vernunftstaat Gesetze gegeben, denen er sich passiv zu beugen hat. Stattdessen betont Schiller des Öfteren, dass der Mensch – und damit meint er alle Menschen – es selbst sein muss, der aus freier Einsicht und selbst vollzogener Willensentscheidung heraus sich selbst die Gesetze aktiv gibt.
|
| [246] |
|
»Ästh. Br.«, S.83
|
| [247] |
|
Dabei ist zu beachten, dass Schiller die physische Gesellschaft im Naturstaat der moralischen im Vernunftstaat nur formal gegenüberstellt; d. h. die Gegenüberstellung ist vom Inhaltlichen her betrachtet nicht als Dualismus zu verstehen wie etwa bei den Gegensatzpaaren »Sinnlichkeit und Verstand«, »Stofftrieb und Formtrieb«, »Zustand und Person«. Denn der Naturstaat soll durch die Vernunft aufgehoben, und das heißt durch den Vernunftstaat in letzter Konsequenz aufgelöst werden, sodass ersterer gänzlich aufhört zu bestehen. Der Naturstaat ist gewissermaßen nur die Plattform, die aber in jedem Fall verlassen werden muss und wird, sobald ein möglicher Vernunftstaat verwirklicht worden ist. Der Unterschied zwischen der unechten Antithetik von Naturstaat und Vernunftstaat einerseits und dem Dualismus der Gegensatzpaare andererseits besteht somit darin, dass jener durch diesen ersetzt wird; wohingegen die Gegensätzlichkeiten der Begriffspaare in einem dialogisch integrierenden Begriff, dem Spielbegriff, aufgehoben werden im Sinne einer wechselseitigen Gemeinsamkeit, d. h. ihre nach wie vor bestehende Verschiedenheit in jenem zu einer Einheit zusammengeschlossen sind, wodurch sie ihre jeweilige Berechtigung keineswegs verlieren, sondern im Gegenteil gerade zu je größerer Wirksamkeit potenzieren.
|
| [248] |
|
Ȁsth. Br., S.86
|
| [249] |
|
Es muss angemerkt werden, dass hier »Vernunft« in der Bedeutung von »Vernünftelei« gemeint ist, und dabei auf folgende Stelle bei Schiller verwiesen werden, wo er sagt, dass der Mensch »durch Vernünftelei von der Natur«, nämlich von seiner sinnlich-vernünftigen Wesensbeschaffenheit abgefallen sei und nur durch eine solche Vernunft, die gleichsam als das alles in sich fassende Obervermögen begriffen werden muss, zu ihr zurückkehren könne (vgl. »Ästh. Br.«, S.89). Denn erst das zeichnet nach Schiller Vernunft im eigentlichen Verständnis aus, dass sie sich selbst im Zusammenspiel mit Welt, mit Materie, mit Empirie begreift, d. h. dass sie sich nicht »vor der faktischen Situation« (S.45) – wie E. M. Wilkinson sagt – verschließt. Deshalb sei es auch nicht verwunderlich, »wenn Schiller in den ›Ästhetischen Briefen‹ oft recht argwöhnisch der Vernunft gegenüber steht« (S.49). Das heißt jedoch nicht, dass er »die Vernunft an und für sich, (...) das Prinzip der ratio« verwirft, sondern lediglich den »Mißbrauch der Vernunft, ihr[en] Mißbrauch durch den Menschen« (S.49).
In einem anderen Aufsatz drückt E. M. Wilkinson das so aus, dass die Vernunft »mitunter gewissermaßen entgleist und Verheerung anrichtet dadurch, daß sie ihr Ziel und Operationsfeld verfehlt durch das, was Schiller eine ›freie Übertretung der Natur‹ nennt« (S.409), wobei »frei« offenbar in pejorativer Bedeutung gebraucht werde.
|
| [250] |
|
»Ästh. Br.«, S.86
|
| [251] |
|
I. Kowatzki, S.44 Anm. – Und weiter heißt es bei I. Kowatzki, dass die »vom Menschen selbst geformte Welt (...) es unmöglich« mache, dass »das Individuum seine Bestimmung zur Seinstotalität verwirklichen kann. Dieses ist in der Tat eine pessimistisch-realistische Auffassung von der Geschichte und beinhaltet, daß eine Fortsetzung der geschichtlichen Entwicklung in der bisher durchgeführten Bahn zur totalen Selbstentfremdung des Menschen führen muß. Ein Rückgängigmachen dieser Entwicklung jedoch würde nach Schiller bedeuten, daß der Mensch in einen Naturzustand zurückfällt. Eine neue Welt kann nur auf der Erneuerung des Menschen gegründet werden.« (S.44 Anm.)
|
| [252] |
|
Schiller gehe nach G. Lukács darüber hinaus noch einen Schritt weiter und konkretisiere nun diese »doppelseitige Verurteilung der Menschen seiner Gegenwart auch in der Richtung ihrer Klassenschichtung« (S.24). Zum Beleg dafür führt G. Lukács folgende Stelle bei Schiller an: »In den niedern und zahlreichern Klassen stellen sich uns rohe gesetzlose Triebe dar (...). Auf der anderen Seite geben uns die zivilisierten Klassen den noch widrigern Anblick der Schlaffheit und Depravation des Charakters« (»Ästh. Br.«, S.88). Jenes interpretiert er nun mit dem Terminus der »gesellschaftlichen Arbeitsteilung« (S.25). Schiller habe zwar durch das Aufdecken des Problems der Zerrissenheit und Depravation des Menschen aufgrund der Arbeitsteilung »die historische Signatur der Gegenwart erblickt« (S.32), worin sich auch seine Leistung zeige, aber dennoch die gesellschaftliche Situation »auf die Zerrissenheit des Menschen in Vernunft und Sinnlichkeit reduziert« und sie idealistisch verwässert bzw. »idealistisch-mystifiziert« (S.32), u. z. deshalb, weil Schiller die Entwicklung des Menschen zur Sittlichkeit nicht im realgeschichtlichen Zusammenhang des feudal-absolutistischen Staates erkannt habe.
Auch P. Kretschmer ist der Ansicht, dass das von Schiller beschriebene Zeitkolorit durch die Konstituierung der »zwei anthropologischen Typen« (S.151), Wilder und Barbar, eine »soziologisch-zeitkritische Komponente mit der These von der Entfremdung durch Arbeitsteilung« (S.151) gewonnen habe.
|
| [253] |
|
Hieraus schließt B. v. Wiese, Schiller hege überhaupt Zweifel am Vernunftstaat, woraus sich das »grundsätzliche Problem« erhebe, »ob und wieweit Schiller an der Idee des Vernunftstaates noch weiter festhält oder ob sich nicht eine entscheidende Umformung in seiner Konzeption« (S.152) vollziehe. Das dies in der Tat zutrifft, wird sich durch die weitere Untersuchung bestätigen lassen.
|
| [254] |
|
G. Rohrmoser, S.132
|
| [255] |
|
G. Rohrmoser, S.132
|
| [256] |
|
vgl. G. Lukács, S.16 und H. Mayer, S.822
|
| [257] |
|
vgl. B. v. Wiese, S.162/63 – Gerade in dem Versuch Schillers, »den sozialen Inhalt der bürgerlichen Revolution ohne Revolution« (S.16) auf ästhetischem Wege zu verwirklichen, die Abspaltung des ästhetischen Subjekts von den realökonomischen Bedingungszusammenhängen mache für G. Lukács die Schillersche Lösung illusionär und unrealistisch.
|
| [258] |
|
In der Gespaltenheit sei nach G. Rohrmoser »das die Zeit im ganzen bestimmende Problem der Entfremdung« (S.132) zu sehen und verdeutliche »gerade das Unversöhnte und Unvermittelte des Überganges von einem zum anderen« (S.132).
|
| [259] |
|
Jene »falsche Identifizierung der abstrakten Natur der Gesellschaft mit der Wirklichkeit im ganzen«, so G. Rohrmoser, habe es Schiller letztlich unmöglich gemacht, »den Schein objektiver Verblendung zu durchschauen, und zwang ihn, die Ohnmacht der objektiven Vernunft endgültig zu machen« (S.134).
|
| [260] |
|
vgl. G. Rohrmoser, S.133 – Schiller habe die Versöhnung als reines Vermögen der Subjektivität gedacht; »versöhnt wird das Subjekt in sich selbst«, aber die Entzweiung außerhalb des Subjekts, d. h. »die Not und Bedürfnisnatur der Gesellschaft (...) bleibt [sic!] von der Versöhnung unberührt« (S.133). Auch für B. v. Wiese ist die Problematik der Versöhnung nicht auf die realgeschichtliche Wirklichkeit unmittelbar beziehbar, d. h., dass »der Prozeß der Gesellschaft und des Staates [nicht] der Garant für den Fortschritt der Menschheit« sei, »sondern immer nur der Mensch selbst, der sich zwar schon in einem Staat vorfindet, jedoch dieses Werk des Zufalls und der Notwendigkeit erst in ein Werk der Freiheit zu verwandeln hat« (S.156/157).
|
| [261] |
|
Schillers vernichtendes Urteil über seine Zeit lautet denn auch: »In seinen Taten malt sich der Mensch, und welche Gestalt ist es, die sich in dem Drama der jetzigen Zeit abbildet! Hier Verwilderung, dort Erschlaffung: die zwei Äußersten des menschlichen Verfalls, und beide in Einem Zeitraum vereinigt.« (Ästh. Br.«, S.83)
|
| [262] |
|
»Ästh. Br.«, S.83
|
| [263] |
|
»Ästh. Br.«, S.83
|
| [264] |
|
»Ästh. Br.«, S.83
|
| [265] |
|
»Ästh. Br.«, S.83
|
| [266] |
|
»Ästh. Br.«, S.83
|
| [267] |
|
Dem Begriff der »Totalität« ist in der Terminologie Schillers eine ähnliche zentrale Bedeutung beizumessen wie dem Begriff des »Spiels«.
|
| [268] |
|
»Ästh. Br.«, S.87
|
| [269] |
|
»Ästh. Br.«, S.87
|
| [270] |
|
»Ästh. Br.«, S.79
|
| [271] |
|
Um es zu wiederholen: Das Zentrum jeder Veränderung, also auch der gesellschaftlich-sozialen ist für Schiller einzig und allein das Individuum; anders ausgedrückt: jede Veränderung hat am Individuum anzusetzen. Dieses muss zuvor entsprechend gebildet sein, wenn die Bildung des Vernunftstaates, des Staates der Freiheit begonnen werden soll. Schiller fragt denn auch in provokativer Manier: »Sollte diese Wirkung [die Wiederherstellung der Totalität des Menschen; v. Verf.] vielleicht von dem Staate zu erwarten sein? Das ist nicht möglich, denn der Staat, wie er jetzt beschaffen ist, hat das Übel veranlaßt, und der Staat, wie ihn die Vernunft in der Idee sich aufgibt, anstatt diese bessere Menschheit begründen zu können, müßte selber erst darauf gegründet werden.« (»Ästh. Br.«, S.97)
|
| [272] |
|
»Ästh. Br.«, S.150 Anm.
|
| [273] |
|
»Ästh. Br.«, S.150 Anm.
|
| [274] |
|
Der Richtigkeit halber muss gesagt werden, dass bei Schiller weniger vom Ästhetischen in der Bedeutung eines substantivischen Sammelbegriffs, sondern vom »ästhetischen Zustand« die Rede ist, den er auf der einen Seite vom »physischen Zustand«, in dem der Mensch bloß die Macht der Natur erleide, und auf der anderen Seite vom »moralischen Zustand«, in dem der Mensch sie beherrsche (»Ästh. Br.«, S.163), unterscheidet. Im »ästhetischen Zustand« sei der Mensch im Gegensatz zu den beiden anderen Zuständen jener jeweiligen Macht entledigt. Für die in diesem Kapitel verfolgte Absicht genügt es indessen, der allgemeineren Wendung, der des »Ästhetischen«, weiterhin den Vorzug zu geben.
|
| [275] |
|
Dadurch, dass Schiller das Umfeld des Ästhetischen in entscheidendem Maße auf das Sinnliche wie auf das Sittliche ausweitet und beides dem Ästhetischen gleichsam integriert, wird die Kantische Ausschließbarkeit des »Entweder – Oder« – wodurch das zweifache Zuordnungsverhältnis der Ästhetik, einerseits zum Erkenntnisvermögen und andererseits zum Gefühlsvermögen (wobei von einer Zuordnung zum Moralischen gänzlich abzusehen ist) – durch die Mittelstellung des Ästhetischen zu einer Einschließung, zu einem »Sowohl – Als auch« umgewandelt. (Vgl. dazu die Definition der Ästhetik wie sie Kant im »Handschriftlichen Nachlaß« N4276 gibt: »Ästhetik ist die Philosophie über die Sinnlichkeit entweder der Erkenntnis oder des Gemüts«.)
Das Charakteristische des Schillerschen Ästhetikverständnisses zeigt sich somit in der beidseitigen, freien Verknüpfung des Ästhetischen sowohl mit dem Sinnlichen als auch – und das ist hier das wichtigste Faktum – mit dem Vernünftigen, d. h. dem Sittlichen.
|
| [276] |
|
»Ästh. Br.«, S.149
|
| [277] |
|
»Ästh. Br.«, S.148
|
| [278] |
|
»Ästh. Br.«, S.150 Anm.
|
| [279] |
|
»Ästh. Br.«, S.150 Anm.
|
| [280] |
|
»Ästh. Br.«, S.150 Anm.
|
| [281] |
|
»Ästh. Br.«, S.150 Anm. – Was Schiller unter »ästhetische[r] Freiheit« versteht, wird aus einer Anmerkung an anderer Stelle deutlich, in der er zwei verschiedene Arten von Freiheit auseinanderhält: Die erste Art ist diejenige, »die dem Menschen, als Intelligenz betrachtet, notwenig zukommt, und ihm weder gegeben noch genommen werden kann«; die zweite Art ist »diejenige, welche sich auf seine [des Menschen, v. Verf.] gemischte Natur gründet«. Und zur näheren Erläuterung führt Schiller aus: »Dadurch, daß der Mensch überhaupt nur vernünftig handelt, bewirkt er eine Freiheit der ersten Art, dadurch, daß er in den Schranken des Stoffes vernünftig, und unter Gesetzen der Vernunft materiell handelt, bewirkt er eine Freiheit der zweiten Art. Man könnte die letztere schlechtweg durch eine natürliche Möglichkeit der ersteren erklären.« (»Ästh. Br.«, S.147 Anm.)
Es ist klar ersichtlich, dass die »ästhetische Freiheit« die zweite Art darstellt und unterschiedlich von der moralischen Freiheit, dem Postulat der praktischen Vernunft, strukturiert ist. Die ästhetische Freiheit ist, einer Formulierung Fr. Burschells zufolge, »das zwischen den Grundtrieben spielerisch schwebende Verhalten« (S.373). Denn das Ästhetische ist zusammengefügt aus Sinnlichkeit und Vernunft, bzw. der ästhetische Zustand stellt die gemischte Natur des Menschen vor und ist, weil jene in ihm ihrer jeweiligen bestimmenden Gewalt enthoben sind, ein freier Zustand.
|
| [282] |
|
»Ästh. Br.«, S.150 Anm.
|
| [283] |
|
»Ästh. Br.«, S.96
|
| [284] |
|
»Ästh. Br.«, S.158
|
| [285] |
|
»Ästh. Br.«, S.158
|
| [286] |
|
I. Kowatzki, S.51/52 – Denn nach I. Kowatzki bestimme der »erreichte Grad der Integration des Menschen zu seiner Seinstotalität (...) auch seine Handlungen, die nach außen gerichtet sind« (S.50 Anm.). Der einzige Unterschied zwischen der »rein ästhetische[n] ›Handlung‹« und der moralischen Handlung, der aber als solcher kein eigentlicher ist, da der Mensch in seiner Vollständigkeit seinem Willen verpflichtet sei, bestehe darin, dass »die rein ästhetische ›Handlung‹ (...) sich im Bewußtsein ab[spielt], während die moralische Handlung immer ein Handeln durch die Tat ist« (S.50 Anm.).
Damit ist es Schiller gelungen, den Vorwurf, dass dem Ästhetischen Willkürlichkeit anhänge, als unberechtigt zurückzuweisen und darüber hinaus dem Ästhetischen eine Erziehungsfunktion beizulegen.
|
| [287] |
|
vgl. F. Böversen, S.454
|
| [288] |
|
»Ästh. Br.«, S.158
|
| [289] |
|
Ein derartiges Prinzip, so argumentiert F. Bövensen, sei »unabhängig von unserem Entschluß« (S.454) und diene »als Ersatz der Tugend dort, wo auf moralisches Handeln nicht zu hoffen ist« (S.454). Und bezüglich der ästhetischen Erziehung sagt er, dass Schiller geglaubt habe, »daß die ästhetische Bildung das Begehren so bilden kann, daß die Neigungen das Gesetz des sittlichen Willens tragen und er das Rechte tut, ohne das Gute immerzu wollen« (S.454);
vgl. dazu »Ästh. Br.«, S.159
|
| [290] |
|
G. Rohrmoser, S.137
|
| [291] |
|
G. Rohrmoser, S. 137
|
| [292] |
|
vgl. F. Böversen, der im Gegensatz dazu der Meinung ist, dass die ästhetische Erziehung mit dem Gedanken des Spiels nur »zu dem genuin in ihr angelegten Ziel gekommen zu sein [schien]« (S.459) und als Beweis dafür auf Schillers Aufsatz »Über die notwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen« verweist. Da jedoch die hier durchgeführte Untersuchung sich ausschließlich auf die »Ästhetischen Briefe« beschränkt, kann dem nicht nachgegangen werden. Indessen ist bereits den bisherigen Ausführungen zu entnehmen und wird sich noch weiter untermauern lassen, dass das Obige im Rahmen der »Ästhetischen Briefe« durchaus als zutreffend anzusehen ist.
|
| [293] |
|
Mit »umfassenderer Ebene« ist im Anschluss an E. M. Wilkinson gemeint, dass der Vernunftbegriff auf dieser »sowohl den begrenzten Begriff gleichen Namens als auch sein Gegenteil« (S.411), in diesem Fall die Sinnlichkeit, in sich vereint. Vernunft müsse hier »großgeschrieben« werden, denn es bedeute eine höhere Vernunft, weil dabei an den Aufwand der Vernunft selbst zu denken sei, der nötig war, um die Totalität dieser zu erreichen. Es handelt sich wieder – wie bereits an anderer Stelle schon erwähnt – um den von E. M. Wilkinson so genannten »Perspektivismus«. Im Zusammenhang mit dem hier betrachteten Sachverhalt muss wiederholt betont werden, dass, sobald die bei Schiller häufig anzutreffende Veränderlichkeit der Perspektive genügend beachtet wird, »einige der sogenannten Inkonsequenzen etwas weniger inkonsequent« (S.411) erscheinen.
|
| [294] |
|
vgl. G. Rohrmoser, S.141 – der allerdings jene Bezeichnung in einem etwas abgewandelten Zusammenhang verwendet und hier nur in Ermangelung einer treffenderen Benennung gewählt worden ist.
|
| [295] |
|
E. M. Wilkinson, S.409
|
| [296] |
|
G. Rohrmoser, S.141
|
| [297] |
|
G. Lukács sieht hier eine neue, noch über den ästhetischen und ethischen Bereich hinausweisende Bedeutung des Spielbegriffs. Schiller habe nämlich durch seine »Theorie der ästhetischen Tätigkeit – in der Theorie des ›Spiels‹« (S.32) den Weg zur Entdeckung der richtigen dialektischen Zusammenhänge in der Entwicklung des Menschen zu sich selbst aufgezeigt. Das finde – so G. Lukács – seine Bestätigung darin, dass Schiller »als zentrale Frage der Ästhetik nicht bloß das ›Anschauen‹, sondern eine Praxis (freilich selbstredend eine idealistische Praxis) sieht, dass er dieser Praxis eine wichtige Stelle im System der Einheit der menschlichen Tätigkeit, der Einheit der Vernunft und Sinnlichkeit« (S.32) einräumt. G. Lukács schließt daraus, dass Schillers Anliegen darin zu sehen sei, im Fortgang der Bildung des Menschen, d. h. im »historischen Wachstum« (S.32) seiner Fähigkeiten, die Gegensätze von Sinnlichkeit und Vernunft als Gegensätzlichkeiten aufzuheben. Indessen, kritisiert G. Lukács, habe Schiller anstatt als Faktor der bürgerlichen Emanzipation die Revolution vorzuschlagen, sich auf die »apologetische (...) Tendenz der ästhetischen Erziehung« (S.17) beschränkt. (vgl. dazu auch H. G. Thalheim, S.142)
|
| [298] |
|
»Ästh. Br.«, S.131
|
| [299] |
|
»Ästh. Br.«, S.112
|
| [300] |
|
»Ästh. Br.«, S.112
|
| [301] |
|
»Ästh. Br.«, S.112
|
| [302] |
|
»Ästh. Br.«, S.79
|
| [303] |
|
So sagt Schiller ausdrücklich, dass dem Begriff der Schönheit nichts widersprechender sei, »als dem Gemüt eine bestimmte Tendenz zu geben« (»Ästh. Br.«, S.157), u. z. weder in belehrender noch in bessernder Hinsicht.
Und an anderer Stelle heißt es, dass die Schönheit »in Rücksicht auf Erkenntnis und Gesinnung für völlig indifferent« zu erklären sei und sie »kein einziges Resultat weder für den Verstand noch für den Willen« abgebe und »keinen einzelnen weder intellektuellen noch moralischen Zweck« ausfülle (»Ästh. Br.«, S.151/152).
|
| [304] |
|
»Ästh. Br.«, S.141
|
| [305] |
|
»Ästh. Br.«, S.161
|
| [306] |
|
Die Grund-Folge-Relation besteht – wie gezeigt wurde – darin, dass einerseits die gegenständliche Entsprechung des Spielbegriffs die Schönheit ist insofern als sie den objektiven Inhalt der subjektiven Beschaffenheit der in freier Tätigkeit befindlichen Gemütskräfte darstellt. Die Schönheit ist also dem Spielbegriff analog strukturiert und bringt infolgedessen die Verknüpfung von Lebendigkeitsdynamik und Gestaltidentität, die für beide charakteristisch ist, zur sinnlichen Darstellung als Freiheit in der Erscheinung. Andererseits erwies sich, dass die Schönheit selbst das dynamische Wechselspiel im subjektiven Bewusstsein erst hervorruft bzw. die Schönheit sich im Spieltrieb »ereignet« (I. Kowatzki, S.52), was besagt, dass letzterer sowohl Folge der Schönheitswahrnehmung als auch zugleich Grund für die Konkretisierung der Schönheit im Bewusstsein ist, d. h. die Schönheit ist gleichermaßen ein durch die subjektive Bewusstseinstat bedingter Gegenstand als auch eine freie, objektive und mithin bedingende Erscheinungsform. Und schließlich zeigte sich der Spieltrieb als das konkretisierte Ziel der ästhetischen Erziehung, d. h. die Erziehungsidee ist in den als korrelativ zu bezeichnenden Ideen der Menschheit und der Schönheit gegründet.
|
| [307] |
|
»Ästh. Br.«, S.153 – Aus diesem Zitat geht, entgegen der bereits erwähnten Ansicht K. Hamburgers, eindeutig hervor, dass es gerade die Schönheit ist, die dem Menschen die Möglichkeit zur Menschheit gewährt, bzw. dass es für Schiller nach wie vor die Schönheit ist, die den Weg zur wahren politischen Freiheit eröffnet. Und erinnert man sich zudem an die von E. M. Wilkinson nachgewiesene, für Schiller charakteristische Argumentationsstruktur der »wechselseitige[n] oder zirkulare[n] Kausalität« (S.416), so ist der Einwand K. Hamburgers, Schiller habe sein anfangs aufgestelltes Ziel aus dem Blick verloren, nicht aufrecht zu halten (vgl. K. Hamburger, S.141).
|
| [308] |
|
»Ästh. Br.«, S.158
|
| [309] |
|
»Ästh. Br.«, S.158
|
| [310] |
|
Denn sowohl im ästhetischen Zustand als auch im Spielbegriff ist dem Menschen die ästhetische Freiheit zurückgegeben, die – wie Schiller erinnernd sagt – »ihm durch die einseitige Nötigung der Natur beim Empfinden, und durch die ausschließende Gesetzgebung beim Denken« (»Ästh. Br.«, S.152) genommen wurde. Beide stellen den notwendigen Freiraum dar, in welchem dem Menschen die Möglichkeit zuteil wird, frei zu wollen, »was er sein soll« (»Ästh. Br.«, S.152), nämlich die sinnlich-vernünftige Wesenseinheit, mithin ein ästhetisch-morali-sches Wesen.
|
| [311] |
|
»Ästh. Br.«, S.139
|
| [312] |
|
»Ästh. Br.«, S.172
|
| [313] |
|
»Ästh. Br.«, S.124
|
| [314] |
|
»Ästh. Br.«, S.172
|
| [315] |
|
»Ästh. Br.«, S.128
|
| [316] |
|
In ähnlicher Weise argumentiert F. Böversen und sieht hierin zu Recht den entscheidenden Unterschied zu Kant; denn für Kant gereicht das Schöne nur zum Symbol der Sittlichkeit; u. z. aufgrund der Trennung der ästhetischen Urteilskraft von der praktischen Vernunft und der prinzipiellen Differenzierung zwischen ihren Wirklichkeitssphären, während für Schiller beide zusammenfallen. Folglich sei »das freie Spiel der Gemütskräfte identisch mit der Selbsttätigkeit der praktischen Vernunft« (S.453). Auch F. Heuer sieht die Schönheit als »Freiheit der Erscheinung« auf »einer Analogie des Urteils der reinen praktischen Vernunft« gegründet insofern als »einem Gegenstand von der Vernunft Freiheit zuerkannt« (S.199) werde.
|
| [317] |
|
»Ästh. Br.«, S.150
|
| [318] |
|
»Ästh. Br.«, S.158
|
| [319] |
|
»Ästh. Br.«, S.131
|
| [320] |
|
»Ästh. Br.«, S.127
|
| [321] |
|
Damit habe nach H.-G. Gadamer Schiller »den transzendentalen Gedanken des Geschmacks in eine moralische Forderung« umgewandelt und »als Imperativ formuliert: verhalte dich ästhetisch«, wodurch »Schiller (...) die radikale Subjektivierung, durch die Kant das Geschmacksurteil und seinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit transzendental gerechtfertigt hatte, aus einer methodischen in eine inhaltliche Voraussetzung gewandelt« (S.77). Es muss allerdings mit F. Böversen hinzugefügt werden, dass Schiller trotzdem »das subjektive Moment noch hat festhalten wollen« (S.452).
Ganz ähnlich interpretiert P. Kretschmer, wenn er formuliert, dass von der ethischen Beurteilung eine Verbindung zur ästhetischen bestehe, »denn schon die Objektivierung schönen sittlichen Verhaltens als Freiheit in der Erscheinung ist ein ästhetisches Phänomen« (S.155). – Vgl. dazu »Ästh. Br.«, S.161 Anm., wo Schiller sagt: »Aber bei Handlungen, welche sich bloß auf einen Zweck beziehen, über diesen Zweck noch hinaus ins Übersinnliche gehen (welches hier nichts anders heißen kann als das Physische ästhetisch ausführen) heißt zugleich über die Pflicht hinaus gehen, indem diese nur vorschreiben kann, daß der Wille heilig sei, nicht daß auch schon die Natur sich geheiligt habe. So gibt es also zwar kein moralisches, aber es gibt ein ästhetisches Übertreffen der Pflicht.« Hieraus folgert P. Kretschmer zu Recht, dass sich für Schiller zwar »eine denkbare Synthese von Neigung und Pflicht herstellen ließe«, indessen es doch Schillers ganzem Wesen widerspräche, »dem Willen eine derart exponierte Funktion einzuräumen« (S.155). Damit stehe Schiller in direkter Opposition zu Kant, weil er ein Handeln fordere, das nicht nur vom sittlichen Imperativ getragen wird und das Sinnliche unterdrückt, sondern das in freier Selbstbestimmung des Menschen Pflicht und Neigung harmonisch verbindet.
|
| [322] |
|
vgl. P. Kretschmer, S.155
|
| [323] |
|
In Anbetracht der hier versuchten zusammenfassenden Betrachtung der Bedeutung des Spielbegriffs wird auf eine eingehende Darlegung des »ästhetischen Scheins« verzichtet. Er findet an dieser Stelle nur deswegen Erwähnung, weil nicht zuletzt durch ihn die »Einheit der Erkenntnis« des Spielbegriffs an Bedeutung gewinnt; zumal Schiller mit dem Begriff des »ästhetischen Scheins«, wie H. Wenzel es bezeichnet, den »Indifferenzpunkt« (S.64) herausgearbeitet habe, in dem die Macht des Sinnlichen aufgehoben sei, sodass sie nicht im Gegensatz zum Ideellen bleibe; andererseits die Macht des Ideellen noch nicht angefangen habe, sodass sie nicht einen Gegensatz zum Sinnlichen bilden könne (vgl. S.63-66).
|
| [324] |
|
»Ästh. Br.«, S.176
|
| [325] |
|
vgl. W. Sdun, S.516
|
| [326] |
|
»Ästh. Br.«, S.175
|
| [327] |
|
vgl. »Ästh. Br.«, S.176, wo es heißt: »Da alles wirkliche Dasein von der Natur als einer fremden Macht, aller Schein aber ursprünglich von dem Menschen als vorstellendem Subjekte, sich herschreibt, so bedient er sich bloß seines absoluten Eigentumsrechts, wenn er den Schein von dem Wesen zurück nimmt, und mit demselben nach eigenen Gesetzen schaltet. Mit ungebundener Freiheit kann er, was die Natur trennte, zusammenfügen, sobald er es nur irgend zusammen denken kann, und trennen, was die Natur verknüpfte, sobald er es nur in seinem Verstande absondern kann. Nichts darf ihm hier heilig sein, als sein eigenes Gesetz, sobald er nur die Markung in Acht nimmt, welche sein Gebiet von dem Dasein der Dinge oder dem Naturgebiete scheidet.
Dieses menschliche Herrscherrecht übt er aus in der Kunst des Scheins, und je strenger er hier das Mein und Dein von einander sondert, je sorgfältiger er die Gestalt von dem Wesen trennt, und je mehr Selbständigkeit er derselben zu geben weiß, desto mehr wird er nicht bloß das reich der Schönheit erweitern, sondern selbst die Grenzen der Wahrheit bewahren (...).«
|
| [328] |
|
Weshalb für B. v. Wiese die ästhetische Versöhnung im Spiel auch nicht auf die geschichtliche Wirklichkeit als beziehbar angesehen werden kann. Schillers Spiel bleibe utopisch, da es nicht in einer realgeschichtlichen Weltmöglichkeit wirksam werde. Dennoch ist nach B. v. Wiese der »utopische Charakter des Spiels« (S.91) nicht ausschließlich negativ zu werten; denn im ästhetischen Zustand des Spiels besitze der Mensch »alles und nichts«: ›nichts‹, »sofern man diesen Zustand an der Wirklichkeit mißt«, welches die negative Seite ausmacht, ›alles‹, »sofern man seinen Zustand als Fülle unbegrenzter Möglichkeiten, auch nach allem Wirklichen gegenüber versteht« (S.91), dieses macht die positive Seite aus. In einem anderen Aufsatz kommt B. v. Wiese deshalb zu dem Ergebnis, dass »der durch den ästhetischen Zustand hindurchgegangene Mensch, der die Versöhnung gleichsam im ›Spiel‹ vorweggenommen hat, nunmehr auch innerhalb des Ernstes der Geschichte die Versöhnung als ein Ziel begreift, das der Geschichte selbst, wenn auch nur in unendlicher Annäherung aufgegeben ist« (S.181).
Auch G. Rohrmoser versteht Schillers ästhetisches Spiel, wenngleich als Vollzug gelungener, mithin erreichter Freiheit, so doch nur möglich außerhalb der historisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit, nämlich in der Sphäre des Scheins. D. h., die »unversöhnte und unversöhnbare Wirklichkeit« (S.133) bleibe bestehen. Deshalb ist »Spiel« für G. Rohrmoser auch keine Tätigkeit, sondern nur eine »Form der Vermögen und Zustände der Subjektivität in sich, als freies Gestimmtsein« (S.133); denn »das Scheinhafte und das Spielerische der ästhetischen Versöhnung trägt der unaufgehobenen und unvermindert andauernden Entfremdung in der gesellschaftlichen Realität Rechnung und rechtfertigt sie zugleich, indem die Möglichkeit einer Versöhnung ästhetisch auf das Subjekt beschränkt bleibt« (S.134).
|
| [329] |
|
»Ästh. Br.«, S.131
|
| [330] |
|
»Ästh. Br.«, S.131
|
| [331] |
|
»Ästh. Br.«, S.81
|
| [332] |
|
Besteht die Interpretation zu Recht, so ist es mithin erlaubt, der im Zitat nicht näher bestimmten Freiheit hier das Attribut »ästhetisch« beizufügen; denn Freiheit als solche kommt dem Menschen nur als »reine Intelligenz« zu, wohingegen die ästhetische Freiheit zum einen auf seiner sinnlich-vernünftigen Doppelnatur, zum anderen auf seiner Endlichkeit gegründet ist.
|
| [333] |
|
Folglich ist auch jene Präposition weniger im Sinne einer lokalen als vielmehr im Sinne einer modalen Relation, bestimmt durch die Art und Weise der Spieltätigkeit hinsichtlich der Schönheit und damit der Freiheit, anzusehen.
|
| [334] |
|
»Ästh. Br.«, S.79
|
| [335] |
|
[gr.: Lebewesen in der Polisgemeinschaft] eine auf den griechischen Philosophen Aristoteles zurückgehende Wesensbestimmung des Menschen; sie besagt, dass der Mensch ein soziales, auf Gemeinschaft angelegtes und Gemeinschaft bildendes Lebewesen ist
|
| [336] |
|
Sofern – und das muss relativierend hinzugefügt werden – die Auslegung der Bedeutung des Schillerschen Spielbegriffs zutreffend ist.
|
| [337] |
|
Dass in dem Spielbegriff Schillerscher Prägung eine kulturphilosophische Dimension zumindest indirekt angelegt ist, muss hier jedoch nur am Rande erwähnt bleiben, da die Absicht der hier vorgelegten Arbeit lediglich in dem Aufzeigen der grundlegenden Aspekte sowie der prinzipiellen Bedeutungskriterien bestand und die kulturelle Perspektive eine dritten Grades darstellt. Es wäre aber durchaus einer eingehenden Untersuchung wert, der Frage hinsichtlich der Beziehung des Schillerschen Spielbegriffs zur Kultur nachzugehen und darüber hinaus zu ermitteln versuchen, inwieweit neuere Ästhetik- und Spieltheorien sich Schillers Begriff des Spiels, wenn auch unter anderen Problemstellungen, so doch in entscheidenden Punkten verpflichtet zeigen, wie etwa E. Fink oder J. Huizinga trotz seiner Kritik an Schiller oder die zwar in anderen Hinsichten über Schiller zweifellos hinausgehenden Spielbegriffskonzeptionen etwa N. Hartmanns oder M. Heideggers.
|
| [338] |
|
vgl. B. Lypp, S.12/13, der in seiner Arbeit über den ästhetischen Absolutismus und die politische Vernunft die These vertritt, dass gerade die Konstruktion jener verlorenen Erfahrungseinheit das hervorstechende Charakteristikum des deutschen Idealismus um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert darstellt und in diesem Zusammenhang auch Schillers Satz von der Ganzheit des Menschen im Spiel anführt.
|
|
|
[zum Inhaltsverzeichnis] |
6. Literaturverzeichnis
6.1. Primärliteratur
Friedrich Schiller
Über die ästhetische Erziehung des Menschen. Briefe an den Augustenberger, Ankündigung der ›Horen‹ und letzte, verbesserte Fassung.
Mit einem Vorwort hrsg. v. Wolfhart Henckmann
München 1967
Schillers sämmtliche Schriften. Historisch-kritische Ausgabe
Hrsg. v. Karl Goedecke u. a.
Stuttgart 1867 – 1876, 17 Bde.
Briefwechsel zwischen Schiller und Körner
Hrsg., ausgew. u. komment. v. Klaus L. Berghahn
München 1973
Immanuel Kant. Werke in zwölf Bänden
Hrsg. v. Wilhelm Weischedel
Wiesbaden 1956ff
6.2. Sekundärliteratur
Baeumler, Alfred
Das Irrationalitätsproblem in der Ästhetik und Logik des 18. Jahrhunderts bis zur Kritik der Urteilskraft
Repr. Nachdr. d. Ausg. Halle 1923
Darmstadt 1967, 2. Aufl.
Bauch, Bruno
Schiller und die Idee der Freiheit
in: Kantstudien 10, 1905, S.346-372
Böhm, Wilhelm
Schillers »Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen«
Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Bd.11
Halle 1927
Böversen, Fritz
Schillers Begriff der ästhetischen Erziehung
in: Zeitschrift für Pädagogik 10, 1964, S.446-461
Burschell, Fritz
Schiller
Hamburg 1968
Cassirer, Ernst
Idee und Gestalt. Goethe, Schiller, Hölderlin, Kleist
Darmstadt 1971
Fink, Eugen
Spiel als Weltsymbol
Stuttgart 1960
Hamburger, Käte
Schillers ästhetisches Denken. Nachwort
in: Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen
Stuttgart 1970
Heidemann, Ingeborg
Der Begriff des Spieles und das ästhetische Weltbild in der Philosophie der Gegenwart
Berlin 1968
Heidemann, Ingeborg
Philosophische Theorien des Spiels
in: Kantstudien 50, 1958/59, S.316-322
Heuer, Fritz
Darstellung der Freiheit. Schillers transzendentale Frage nach der Kunst
Köln 1970
Janke, Wolfgang
Die Zeit in der Zeit aufheben. Der transzendentale Weg in Schillers Philosophie der Schönheit
in: Kantstudien 58, 1967, S.433-457
Kowatzki, Irmgard
Der Begriff des Spiels als ästhetisches Problem. Von Schiller bis Benn
Bern / Frankfurt 1973
Kössler, Henning
Freiheit und Ohnmacht. Die autonome Moral und Schillers Idealismus der Freiheit
Göttingen 1962
Kretschmer, Paul
Dualismus und das Streben nach Synthese in den philosophischen Schriften Friedrich Schillers
Münster 1971
Kühne, Otto
Schöne Kunst und Lebenskunst. Betrachtungen zu Schillers Lebensauffassung im Lichte der Polaritätstheorie
in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 36,
1942, S.65-78 und S.147-165
Lukács, Georg
Beiträge zur Geschichte der Ästhetik
Berlin 1954
Lypp, Bernhard
Ästhetischer Absolutismus und politische Vernunft. Zum Widerstreit von Reflexion und Sittlichkeit im deutschen Idealismus
Frankfurt 1972
Materialien zu Kants »Kritik der Urteilskraft«
Hrsg. v. Jens Kulenkampff
Frankfurt 1974
Mayer, Hans
Der Moralist und das Spiel. Zu Friedrich Schillers theoretischen Schriften
in: Schillers Werke. Vierter Band, Anhang
Frankfurt 1966, S.809-825
Mugdan, Bertha
Die theoretischen Grundlagen der Schillerschen Philosophie
Kantstudien, Ergänzungsheft Nr. 19
Berlin 1910
Nivelle, Armand
Kunst- und Dichtungstheorien zwischen Aufklärung und Klassik
Berlin / New York 1971, 2. Aufl.
Rasch, Wolfdietrich
Schein, Spiel und Kunst in der Anschauung Schillers
in: Wirkendes Wort 10, Heft 1, 1960, S.2-13
Rohrmoser, Günter
Zum Problem der ästhetischen Versöhnung. Schiller und Hegel
in: Festschrift des Euphorion. Schiller zum 10. November 1959
Heidelberg 1959, S.129-144
Sayce, Olive
Das Problem der Vieldeutigkeit in Schillers Terminologie
in: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, 6. Jahrgang, 1962,
S.149-177
Sdun, Winfried
Zum Begriff des Spiels bei Kant und Schiller
in: Kantstudien 57, 1966, S.500-518
Thalheim, Hans-Günther
Schillers Stellung zur Französischen Revolution und zum Revolutionsproblem
in: Hans-Günther Thalheim, Zur Literatur der Goethezeit
Berlin 1969, S.118-145
Trebels, Andreas Heinrich
Einbildungskraft und Spiel. Untersuchungen zur Kantischen Ästhetik
Bonn 1967
Tumarkin, Anna
Zur transcendentalen Methode der Kantischen Ästhetik
in: Kantstudien 11, 1906 S.348-378
Volkmann-Schluck, K. H.
Die Kunst und der Mensch. Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen
Frankfurt 1964
Wenzel, Heinz
Das Problem des Scheins in der Ästhetik. Schillers »Ästhetische Briefe«
Köln 1958
Wernly, Julia
Prolegomena zu einem Lexikon der ästhetisch-ethischen Terminologie Friedrich Schillers.
Repr. Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1909
Hildesheim 1975
Wertheim, Ursula
Schillers Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Französischen Revolution
in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität
Jena 8, 1958/59, S.429-449
Wiese, Benno von
Das Problem der ästhetischen Versöhnung bei Schiller und Hegel
in: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, 9. Jahrgang, 1965,
S.167-188
Wiese, Benno von
Schiller und die französische Revolution
in: Benno von Wiese, Der Mensch in der Dichtung
1958, S.148-169
Wiese, Benno von
Die Utopie des Ästhetischen bei Schiller
in: Benno von Wiese, Zwischen Utopie und Wirklichkeit. Studien zur
deutschen Literatur
Düsseldorf 1963, S.81-101
Wilkinson, Elizabeth M.
Schiller und die Idee der Aufklärung. Betrachtungen anläßlich der Briefe über die ästhetische Erziehung
in: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, 4. Jahrgang, 1960,
S.42-59
Wilkinson, Elizabeth M.
Zur Sprache und Struktur der Ästhetischen Briefe
in: Akzente, 6. Jahrgang, 1959, S.389-418
Windelband, W.
Schillers transcendentaler Idealismus
in: Kantstudien 10, 1905, S.398-411
[zum Inhaltsverzeichnis]
|